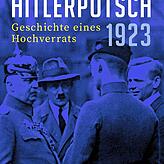Herr Niess, das Datum 9. November transportiert heute in erster Linie die Erinnerung an den Mauerfall 1989 und an das Pogrom gegen die deutschen Juden von 1938. Warum dürfen wir den 9. November 1923 nicht vergessen?
Wir sollten ihn nicht vergessen, weil er uns wichtige Antworten gibt auf die Frage, wo damals die Feinde der Demokratie saßen und auf welche Art und Weise die Weimarer Republik zerstört wurde. Das lässt sich bereits in dieser frühen Krisenphase erkennen. Damals spielte Adolf Hitler als Führer der NSDAP zwar eine wichtige demokratiefeindliche Rolle, aber nicht er allein. Mir kommt es auch auf andere Kräfte an, die beim sogenannten „Hitlerputsch“ in Erscheinung traten.

Von welchen Kräften sprechen wir da?
Hitler trat am 8. November 1923 im Bürgerbräukeller in einer Versammlung auf, die er gar nicht einberufen hatte. Im Zentrum stand der nationalkonservative bayerische Politiker und Generalstaatskommissar Gustav von Kahr, der sein Programm einer nationalen Diktatur vorstellen wollte. Mit Waffengewalt sprengte Hitler diese Versammlung und nahm neben Kahr zwei weitere führende Persönlichkeiten in einem Nebenzimmer beiseite: den Kommandeur der bayerischen Reichswehrdivision, Otto von Lossow, und den Chef der Bayerischen Landespolizei, Hans von Seißer.

Das bedeutet, dass es bereits eine enge Verbindung zwischen diesen vier Akteuren gab?
Genau. Die Aktion Hitlers war letztlich nichts anderes, als der Versuch, Männer, die mit ihm über Wochen eng zusammengearbeitet hatten, wieder mit ins Boot zu holen. Kahr, Lossow und Seißer hatten geplant, mit militärischem Druck, mit einem „Marsch auf Berlin“ die Demokratie zu beseitigen und eine nationale Diktatur zu errichten. Hitler mit seiner NSDAP und seiner SA waren in diese Pläne einbezogen, genau wie andere rechtsextreme paramilitärische Verbände, die es damals in Bayern zuhauf gab. Hitler drängte am 8. November darauf, die geplante gemeinsame Aktion in die Tat umsetzen.

Warum waren diese Kräfte gerade in Bayern so stark?
Bayern war in gewisser Weise ein Sonderfall. In München wurde im Frühjahr 1919 eine linke Räterepublik ausgerufen, die mit Hilfe von rechtsgerichteten Freikorps-Einheiten beseitigt wurde. Danach entstanden Wehrverbände und paramilitärische Formationen, die über eigene Waffen verfügten und von der Reichswehr ausgebildet wurden, auch um die Restriktionen des Versailler Vertrags zu umgehen. Teilweise hörten diese sogenannten vaterländischen Verbände auf Hitler, teilweise waren sie völlig unabhängig von ihm.
Sie wollten die Republik beseitigen
Haben wir es hier mit einer Art Vortrupp zum Sturz der Demokratie zu tun?
So könnte man es sagen. Schon in Kahrs Zeit als Ministerpräsident – von März 1920 bis September 1921 – hatte sich in Bayern die Vorstellung verbreitet, der Freistaat müsse zur „Ordnungszelle“ des Reiches werden. Hier fanden Rechtsextremisten, denen der Boden in anderen Regionen Deutschlands zu heiß wurde, einen Rückzugsraum. So wurde Bayern in den frühen 20er-Jahren zu einem El Dorado des Rechtsextremismus.
Die nationalistischen Kreise empörten sich dann Ende September 1923 über die Entscheidung der Reichsregierung, den Widerstand gegen die Besetzung des Ruhrgebiets abzubrechen, in das Franzosen und Belgier Anfang 1923 einmarschiert waren. Auch die weit rechts stehende bürgerliche Regierung in Bayern sah jetzt den Zeitpunkt gekommen, um die angeblich jüdisch und marxistisch verseuchte Demokratie in Berlin zu beseitigen.
Hätten die bewaffneten Verbände Bayerns denn die Chance gehabt, bis nach Berlin zu kommen?
Die Vorbereitungen liefen jedenfalls auf Hochtouren. Bayern rief nach dem Ende des Ruhrkampfs den Ausnahmezustand aus, und von Kahr wurde Generalstaatskommissar mit umfassenden Vollmachten. Er eskalierte dann seit längerem vorhandene Konflikte mit dem Reich ganz massiv. General von Lossow hat sich auf Kahrs Seite geschlagen, die Ausführung von Befehlen aus Berlin verweigert und wurde in der Folge offiziell entlassen.
Bayern hat daraufhin Lossow als „Landeskommandant“ wieder eingesetzt und dann auch gleich die in Bayern stationierte Reichswehrdivision auf den Freistaat Bayern verpflichtet – ein klarer Verfassungsbruch. Der Plan der Republikfeinde sah vor, die Division mit Hilfe der Wehrverbände auf drei Divisionen aufzustocken. Das war eine ernstzunehmende militärische Kraft.
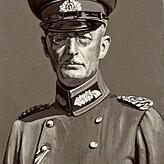
Drohte da keine blutige Konfrontation?
Die Münchner Akteure waren unsicher. Bisher galt immer die Devise „Truppe schießt nicht auf Truppe“. Zudem waren die Verbindungen zum Chef der Heeresleitung, General Hans von Seeckt, durchaus freundschaftlich. Seeckt war ja selbst ein Gegner der Demokratie, wollte deren Beseitigung aber durch politische Manöver erreichen und setzte auf Hungerrevolten, die ein Eingreifen der Reichswehr ermöglicht hätten. Daher wollte er die Entwicklung abwarten. Seeckts Reaktion auf einen möglichen Vormarsch bayerischer Verbände war kaum vorauszusehen.
Kann Hitlers Schlag im Bürgerbräukeller und der anschließende Marsch durch München auch damit begründet sein, dass er angesichts der Macht von Kahr, Lossow und Seißer befürchtete, als reiner Bierzelt-Agitator marginalisiert zu werden?
Das hat sicher eine Rolle gespielt. Dazu kam, dass Hitler seine Truppe schon längere Zeit in Bereitschaft gehalten hatte. Da gab es also Druck von unten, und es gab die Befürchtung, Kahr könnte am Ende Reichspräsident werden, andere würden die Regierungsgeschäfte leiten und Hitler ginge leer aus. Aber im Kern gab es zwischen Kahr, Seißer und Lossow einerseits und Hitler andererseits mehr Übereinstimmung als Differenzen, auch über die anzuwendenden Gewaltmethoden. Das rechte Triumvirat wurde Anfang November allerdings zögerlich, nachdem es Rücksprache mit Seeckt gehalten hatte, aber es gab seine Umsturzpläne nicht auf.

Also hätte man nach dem Scheitern des von Hitler und dem Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff angeführten Putsches am 9. November auch das Triumvirat anklagen müssen, was nicht geschah. Muss man das nicht – mit Blick auf das Erstarken der Rechten heute – deutlich betonen?
Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Damals ging die Gefahr eben nicht nur von der extremsten, von Hitler und seiner NSDAP verkörperten Rechten, aus, sondern auch von den national-konservativen Kreisen um Kahr, Seißer und Lossow. Diese Gruppe war 1923 im Grunde viel gefährlicher als die extreme Rechte um Hitler, die allein keine ernstzunehmende militärische Gefahr darstellte. In der Tat war es ein Skandal, dass der Prozess nicht vor dem zuständigen Reichsgericht in Leipzig, sondern in München stattfand.
. . . wo die Justiz den Angeklagten besonders gewogen war?
So ist es. Dort wurde vor einem „Volksgericht“ verhandelt, einem Überbleibsel aus der Revolutionszeit. Hier wurden Letztentscheidungen getroffen, Berufung nicht möglich, Revision ausgeschlossen. Wenn Bayern schon einen Prozess gegen Hitler nicht verhindern konnte, hoffte man darauf, ihn im eigenen Land und mit dem sehr weit rechtsstehenden Richter Georg Neithardt besser steuern zu können. Am Ende stand mit den grob rechtsbeugenden Urteilen und den milden Strafen für Hitler und seine Kumpane ein veritabler Justizskandal.

Ist Hitler durch den Prozess und eine kurze Haft in der Festung Landsberg populärer geworden?
Er wurde auf Reichsebene zu einer politischen Figur, die man jetzt kannte. Vor dem Putsch war er eine Münchner Lokalgröße, im Norden war er kaum bekannt. Das hat sich durch den 9. November verändert. Aber es war nicht so, dass die NSDAP nach dem Ende ihres Verbots 1925 immer stärker geworden wäre. 1928 kam die Partei bei den Reichstagswahlen auf nur 2,6 Prozent.
Ein Ergebnis der Stabilisierung der Weimarer Republik?
Ja, ganz eindeutig. Als die Not des Jahres 1923 überwunden war und eine wirtschaftliche Erholung einsetzte, verloren die ganzen Extremisten, auch die Nazis, stark an Popularität. Das änderte sich erst durch die Weltwirtschaftskrise, die Deutschland hart traf. Daher kann man als Lehre aus Weimar mitnehmen: Krisen treiben Menschen zu extremen Wahlentscheidungen, und das passiert ausgesprochen schnell. So erhielt die NSDAP 1930 schon 18,3 Prozent. Dieses Tempo müssen wir uns heute bewusst machen, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen.
Also zeigt sich doch, dass die Kritik, Weimar sei eine „Demokratie ohne Demokraten“ gewesen, falsch ist?
Dem stimme ich zu. Die Weimarer Republik war keineswegs zum Scheitern verurteilt. Ende 1923 konnte man davon ausgehen, dass sie das Schlimmste hinter sich hatte. Sowohl die SPD als auch die katholische Zentrumspartei zeigten sich als zuverlässige Träger der Demokratie mit stabiler Basis. Man kann den wirtschaftlichen Totalkollaps 1929 nicht mit den Herausforderungen von heute vergleichen, aber es gibt eine ähnliche Tendenz: Dass Menschen, die unzufrieden sind, nach einer Alternative suchen, ohne dass sie selbst von vornherein rechtsextremistisch sind.
Buchtipp: Wolfgang Niess: Der Hitlerputsch 1923 – Geschichte eines Hochverrats, C.H.Beck-Verlag, 350 Seiten, 30 Abbildungen, 26 Euro.