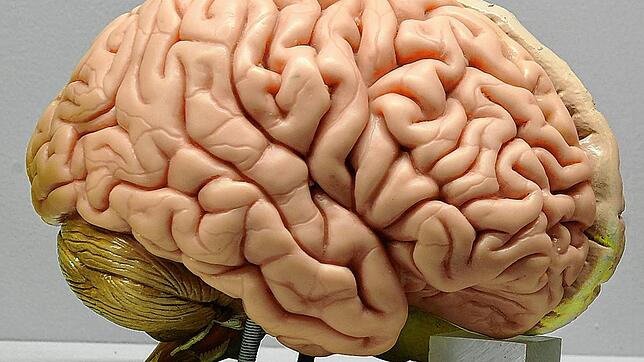Von vielen Worten geht ein Zauber aus. Intelligenz gehört sicher dazu. Jeder möchte sie besitzen, genauso wie Geld, gutes Aussehen und die Sympathie der Mitmenschen. Intelligenz ist der Schlüssel zu einem besseren Leben. Wer sie hat, dem öffnen sich Türen, die anderen, weniger mit Klugheit Gesegneten, meist verschlossen bleiben.
Sollte man meinen. Sieht man genauer hin, wird es zunehmend schwierig, sich auf ein gemeinsames Verständnis von Intelligenz zu einigen. Die Hirnforscher verbinden damit sehr nüchtern die Schnelligkeit der Informationsverarbeitung und sprechen von kognitiver Leistungsfähigkeit.
Intelligenz hat auch mit Effizienz zu tun
Der im vergangenen Jahr verstorbene bekannte Intelligenzforscher und Autor Gerhard Roth brachte es gegenüber dem Autor dieses Artikels einmal so auf den Punkt: „Intelligenz ist die Fähigkeit zum Problemlösen unter Zeitdruck.“
Wer ein mathematisches Rätsel schneller knacken kann als sein Konkurrent, ist auch deshalb intelligenter als dieser, weil sein Gehirn beim Denken weniger Energie verbraucht. Man könnte also sagen: Effizienz entscheidet über den Grad an Intelligenz.

Wenn es so einfach wäre! Das Thema ist eben doch komplexer, weil lange anerkannte Grenzen verschwimmen. Die öffentliche Debatte hat den Begriff der Intelligenz keineswegs geschont, sondern nach mehreren Richtungen aufgeweicht.
Die bekannteste Neo-Variante ist die emotionale Intelligenz oder auch soziale Intelligenz, die sich Personalentwickler, Mentalcoaches und Psychologen ausgedacht haben, um die Fähigkeit zu Empathie und Miteinander als neue und Marketing-fähige Kategorie in der Sammlung menschlicher Pluspunkte zu etablieren.
Ein kühner Kunstgriff
So plausibel es auf den ersten Blick wirkt, die Intelligenz von der Bindung an nerdige Überflieger zu entkoppeln – es handelt sich im Vergleich zur klassischen Intelligenz der Hirnforscher um einen kühnen Kunstgriff, um nicht zu sagen: um Irreführung. Kritiker sagen zu Recht, dass emotionale Intelligenz durch Tests nicht zu messen sei und es dem Ansatz daher an Wissenschaftlichkeit mangele.
In der Tat: Sind Emotionen und Gefühle auf einer Skala zu bewerten? Und ist die Fähigkeit eines Menschen zu sozialem Miteinander, zu Balance, Moderation und Diplomatie letztlich nicht auch an die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen rückgebunden?
Es bleibt also doch nichts anderes übrig, als in die Mess- und Zahlenwelt einzutauchen, wenn man wissen will, wie klug ein Mensch ist und ob man ihn etwa als Hochbegabten bezeichnen kann. Seit 150 Jahren gehen Forscher der Frage nach, warum geistiges Potenzial und Grips so unterschiedlich verteilt sind.
Lehrer erfahren das tagtäglich, und die Unterschiede sind eben nicht alle damit zu erklären, dass es dem einen an Förderung und Zuwendung mangelt und dem anderen nicht. Dieser Feststellung kann man nicht ausweichen: Löst ein jüngeres Kind in der gleichen Zeit so viele Aufgaben wie ein oder mehrere ältere Kinder, ist es offensichtlich überdurchschnittlich intelligent.
Intelligenz als Anpassungsfähigkeit
Diesen Unterschied fasste der deutsche Psychologe William Stern in ein Modell, das noch heute unter dem Kürzel IQ (für Intelligenzquotient) jeder kennt. Stern legte den mittleren IQ bei 100 fest und richtete die Messung der Intelligenz nach der Abweichung von diesem Wert nach oben oder unten aus.
Für unsere heutigen Ohren etwas blumig formuliert sah Stern die Intelligenz als „allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens“. Da denkt man zunächst nicht an Mathe-Aufgaben, sondern an Flexibilität, Kreativität und Lernwillen, aber letztlich läuft es auf das hinaus, was heute an jeder Ecke als Lösung angepriesen wird, egal ob es sich um einen LKW-Transport, eine Geldanlage oder eine Hightech-Waffe handelt.
Wessen IQ nach oben abweicht, der beschert dem Patentamt also eher Arbeit als ein Kandidat, der unter dem geistigen Schnitt liegt. Zur Beruhigung des Lesers: Bei 70 Prozent aller Menschen liegt der IQ um den Mittelwert 100. Bei 115 blitzt die Klugheit schnell erkennbar auf, bei unter 85 überwiegt der Eindruck geistiger Beschränktheit. Das will natürlich keiner!
Deshalb sind auch viele Akademiker-Paare der Meinung, ihr Nachwuchs sei vor Dummheit gefeit, weil die sich paarende Intelligenz mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder Intelligenz hervorbringe. Aber gilt das Motto „Einmal schlau, immer schlau“ wirklich?
Alkohol wirkt sich auf IQ des Kindes aus
Leider gibt es dafür keine Garantie. „Es gibt nicht DAS Intelligenzgen“, schreibt Elsbeth Stern, Professorin für Lehr- und Lernforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Vielmehr sei die Vererbung von Intelligenz ein Vabanquespiel.
Was sich fast nach reiner Glückssache anhört, basiert auf einem unkalkulierbaren Gen-Haushalt. Denn an der Entwicklung von Intelligenz, so Stern, seien sehr viele Genvariationen beteiligt – und diese entfalteten ihre Wirkung nur unter bestimmten Umweltbedingungen. Im drastischen Klartext: Trinkt die Mutter Alkohol, so kann das den IQ des Kindes drücken.

Wir müssen uns also mit einer gewissen Intelligenz-Lotterie abfinden. Kluge Eltern haben kein Abo auf klassenbeste Kinder, was – so Stern – auch am „Regressionseffekt zur Mitte“ liegt. Bildlich gesprochen: Wären die IQ-Punkte der Top-Akademiker Kieselsteine, die einen Kegel bilden, so hätte dieser die Tendenz, sich am Boden zu verteilen. „Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sehr intelligente Eltern Kinder bekommen, die etwas weniger intelligent sind als sie selbst, größer als 50 Prozent“, so Forscherin Stern.
Genauso ernüchternd für solche Eltern ist die Tatsache, dass nur etwa 50 bis 55 Prozent der Intelligenz genetisch weitergegeben wird. 35 bis 40 Prozent steuert die Umwelt nach der Geburt bei. Die Herkunft des restlichen Anteils liegt noch im Dunkeln. Dennoch: Diese Zahlen machen Hoffnung, sagen sie uns doch, dass Intelligenz nur zu einem gewissen Maß eine feste Größe ist, die durch Bildung und Förderung gesteigert werden kann.
Kinder können ihren IQ noch steigern
Für alle Lehrer, Eltern und Bildungsforscher gibt es also Hoffnung. Gerhard Roth sah sogar ein hohes Entwicklungspotenzial, als er sagte: „Wenn ein Kind mit einem IQ von 100 geboren wird, könnte es bei bester Förderung auf 115 bis 120 kommen.“ Im Gegenzug könne der IQ bei Vernachlässigung und häuslicher Gewalt auf 85 bis 80 sinken.
Das Potenzial der Bildbarkeit sinkt indes mit dem Alter. Bei Zehnjährigen rechnet man mit einem Plus oder Minus von 10 IQ-Punkten, Erwachsene können sich maximal noch um 5 Punkte steigern, aber nur – so Roth – wenn man etwa durch Gedächtnistraining „lang anhaltend übt“. Wird man faul, verpufft der Effekt wieder.
Viele kluge Kinder bleiben draußen
Bedauerlich, dass die Ergebnisse der Intelligenzforschung politisch keine hohen Wellen schlagen. Würde man jene ernster nehmen, müsste man Kindern aus niedrigeren sozialen Schichten bis hin zum Prekariat einen Besuch von Gymnasium und Universität deutlich erleichtern.
Doch die Karrieren „aus kleinen Verhältnissen“, wie man früher sagte, sind selten geworden. Dagegen bevölkern Kinder aus Akademiker-Familien in Massen die höheren Schulen, obwohl vielen dafür IQ, Fähigkeiten und Motivation fehlen. Viele kluge Kinder bleiben dagegen draußen, weil die Chancengleichheit nur ein Wunschbild ist.
Nutzt unsere vermeintliche Wissensgesellschaft ihre Ressourcen an Intelligenz also zielgenau? Wohl kaum. Zwar verlässt mittlerweile die Hälfte eines Jahrgangs die Schule mit einem Abitur, doch an den Universitäten ist die Abbrecher-Quote hoch. Forscher wie Elsbeth Stern beklagen den „Bedeutungsverlust der Intelligenz beim Zugang zu Universitätsbildung“. Sitzen die Falschen in den Gymnasien? Das wäre provokant zu fragen.
Sollten IQ-Tests an Grundschulen die Noten von Klassenarbeiten ersetzen? Zumindest würde das den Blick für das geistige Potenzial eines Kindes schärfen – unabhängig vom Einkommen der Eltern. Inzwischen können Forscher an der Universität Tübingen in Gehirn-Scans das Niveau des IQ durch maschinelles Lernen sichtbar machen. Die Künstliche Intelligenz beflügelt die Forschung, aber die Aufgaben setzen muss der Mensch. Entscheidet am Ende immer die humane Intelligenz? Genau das sollte unsere Bemühung sein.