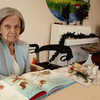Die 60.000-Marke ist bald überschritten. Tendenz steigend. Zwar sinkt die sogenannte Inzidenz, also der Wert, wie viele Menschen sich durchschnittlich pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit Corona anstecken, doch die Todeszahlen bleiben hoch. Erschreckend hoch.
Aber bedeutet das, dass es eine Übersterblichkeit durch Corona gibt, sterben also mehr Menschen aufgrund der Pandemie? Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Zwar liefert das Robert-Koch-Institut Zahlen, wie viele Menschen an oder mit Corona gestorben sind. Doch ihre Interpretation ist schwieriger als erwartet.
These 1: Durch Corona starben mehr Menschen
Unsere Auswertungen zeigen, dass während der ersten und nun vor allem während der zweiten Welle mehr Menschen gestorben sind als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Wir legen unsere Daten zwei Experten vor. Werner Brachat-Schwarz ist beim Statistischen Landesamt für die Bevölkerungsentwicklung zuständig. Er muss es wissen, denken wir.
Er sagt: Noch von Januar bis Oktober 2020 habe vieles „auf eine eher geringe Übersterblichkeit in Baden-Württemberg" hingedeutet, berücksichtige man aber die beiden letzten Monate des Jahres, seien „deutliche höhere“ Sterbefallzahlen als in den Vorjahresmonaten zu verzeichnen. Demnach starben in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr immerhin rund 4.000 Menschen mehr als in den beiden Vorjahren. Dabei gab es 2018 eine schwere Grippewelle.

Trotzdem könnten auch andere Faktoren wie Temperatur- und Wetterschwankungen eine Rolle spielen bei den Todeszahlen. „Erfahrungsgemäß“ schwankten die Zahlen auch mit Blick auf diese Faktoren. Und: „Schließlich ist zu bedenken, dass die auch aufgrund der Alterung der Bevölkerung von Jahr zu Jahr tendenziell zunehmen.“
Eine Nachfrage beim Statistischen Bundesamt ergibt: Tatsächlich lasse sich mit Blick auf die Pandemie während der ersten Welle im April und seit Mitte Oktober eine „solche Entwicklung“, also eine Übersterblichkeit, konstatieren, wie Sprecherin Jutta Hiemer dem SÜDKURIER auf Anfrage sagt. Auch das Robert-Koch-Institut sieht die Übersterblichkeit durch seine Daten bestätigt.
Auch den Medizinstatistiker Gerd Antes aus Freiburg haben wir befragt. Er sieht die Daten vom RKI, die wir ausgewertet haben und unsere daraus entstandenen Thesen deutlich kritischer. „Es geht schon damit los, dass durch die Infektionsschutzmaßnahmen gegen Corona auch die Todesfälle durch die normale Influenza gesunken sind“, gibt er zu bedenken. Das berücksichtigt die Statistik tatsächlich nicht.
Aber heißt das im Umkehrschluss, dass eigentlich noch mehr Menschen gestorben wären, wenn es die Infektionsschutzmaßnahmen nicht gäbe? Weil dann eventuell noch die Toten der Grippewelle hinzukämen? Das lässt sich im Nachhinein schwer beantworten.
Die Einschätzung des Statistischen Bundesamts bietet aber eine Orientierung. Dort bestätigt ein Sprecher dem SÜDKURIER: „Ab März 2020 lassen sich die Zahlen nur vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie interpretieren.“ Demnach können die Maßnahmen auch dafür gesorgt haben, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wie die Grippe verursacht werden. Aber auch Rückgänge oder Anstiege bei anderen Todesursachen können demzufolge die Sterbefallzahlen beeinflussen.
Antes sieht es ähnlich: Es könne sein, dass die Sterblichkeit insgesamt geringer ist als im Vergleich zu einem heftigen Influenza-Jahr. Doch dafür einen Zusammenhang mit Corona herzustellen, ist schwierig. Denn auch saisonale Effekte spielten eine Rolle. In manchen Jahren kommt die Grippe früher oder später, so dass in einem Monat eine Übersterblichkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat entstehen könnte, im Jahresdurchschnitt aber keine große Veränderung zu sehen ist. Er mahnt zur Vorsicht: „Ich würde nichts mit Bestimmtheit sagen.“
Unser nächste These ist praktisch schon belegt. Trotzdem stellen wir so auf die Probe:
These 2: Über 80-Jährige sterben häufiger an Corona
Für das Robert-Koch-Institut ist die Antwort eindeutig: „Ja, die Sterblichkeit steigt mit dem Alter“, wie Sprecherin Susanne Glasmacher dem SÜDKURIER auf Nachfrage sagt.
Der Experte vom Landesstatistikamt, Brachat-Schwarz, hält sie für „plausibel“. Auch Antes gibt hier grünes Licht. Im Fall von Corona liege eine sehr starke Altersabhängigkeit bei den Todesfällen vor. Die Mortalität steigt bei Senioren stärker an.
Das bestätigt auch ein Blick auf die Zahlen des Statistischen Bundesamts: „Die gestiegenen Sterbefallzahlen im Jahr 2020 sind größtenteils auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen zurückzuführen“, heißt es dort. So starben 2020 insgesamt mindestens 576.646 Menschen über 80. Das sind 41.152 beziehungsweise acht Prozent mehr als 2019.
Allerdings fallen durch die Alterung der Gesellschaft auch jedes Jahr mehr Menschen in diese Kategorie. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts dürften dies 2020 etwa vier bis fünf Prozent mehr sein als noch im Vorjahr. Dennoch ist die Zunahme auffällig, zumal die Sterbefallzahlen der unter 80-Jährigen auf dem Vorjahresniveau liegen. Die geringe Zunahme von 1817 Fällen gilt hier nicht als relevant.
Unser nächste These setzt sich aus den ersten beiden Annahmen zusammen:
These 3: Je höher die Infektionszahlen, desto höher die Sterberate
Das Robert-Koch-Institut sieht das als bestätigt. „Ja, bei steigender Inzidenz steigt grundsätzlich auch die Mortalität.“ Auch Landesstatistiker Brachat-Schwarz hält die Schlussfolgerung für plausibel.
Das Statistische Bundesamt sagt zu unserer Anfrage: „Wir haben keine derartigen Analysen durchgeführt. Ein Zusammenhang erscheint aber sehr naheliegend.“ So sei mit Blick auf erhöhte Sterbefallzahlen „Bundesländer besonders auffällig, aus denen hohe Infektionszahlen gemeldet wurden“. In der ersten Welle betraf das vor allem Baden-Württemberg und Bayern.
In der zweiten Welle verlagerte sich dieser Effekt eher auf die ostdeutschen Bundesländer – „insbesondere Sachsen, aber auch Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt wiesen sowohl erhöhte Sterbefallzahlen als auch vergleichsweise hohe Inzidenzen auf“, erklärt die Sprecherin des Bundesamts.

Medizinstatistiker Antes sieht es differenzierter: Die These sei „qualitativ plausibel“. Doch um eine Aussage treffen zu können, müsste man zunächst feststellen, wie homogen überhaupt in Baden-Württemberg getestet wird. Todesfälle werden gemeldet, ja. Aber wie zuverlässig sind die Infektionszahlen? Die Dunkelziffer könnte hier einen großen Einfluss auf unsere These haben.
Antes sagt noch etwas Spannendes: „Wenn man Junge und Alte trennen könnte, könnte man vieles öffnen und würde es an den Sterberaten kaum sehen.“ Das passt zu unserer nächsten These:
These 4: Die Unter-60-Jährigen sind die Pandemietreiber
Das Robert-Koch-Institut wird hier zurückhaltender: „Das können wir nicht bestätigen“, sagt Sprecherin Susanne Glasmacher zu unserer These. So sei die Inzidenz zwar in der Gruppe der 15 bis 65-Jährigen zuletzt erhöht gewesen, aber eben auch bei den über 80-Jährigen. „Das zeigt, dass weitere Bereiche der Bevölkerung betroffen sind“, folgert das RKI. In welcher Gruppe und Region das Infektionsgeschehen gerade besonders dynamisch verlaufe, ändere sich im Verlauf der Epidemie, ergänzt die Sprecherin.
Auch Landesstatistiker Brachat-Schwarz ist hier strenger in der Bewertung: Zwar könnte für unsere These einerseits sprechen,“ dass die jüngeren und mittleren Altersgruppen im Schnitt – allein bereits beruflich bedingt – sicherlich mehr Kontakte mit anderen Menschen haben als Ältere und deshalb rein statistisch eine höhere Gefahr besteht, dass sie das Virus besonders stark verbreiten“.
Andererseits „ist ja gerade ein Problem bei der Verbreitung des Virus, dass ein Teil der Infizierten keine Symptome zeigt; wenn dieser Anteil aber bei Älteren geringer wäre, wäre bei ihnen auch die Gefahr kleiner, dass sie unbewusst das Virus weiter verbreiten“. Kurzum: „Die These nur nach Altersklassen scheint mir aber generell zweifelhaft; die Forschung dazu läuft und wird Ergebnisse zeigen.“ Kurzum, klar belegen lässt sich die Annahme derzeit nicht.
Antes ist hier einmal nachgiebig mit uns: „Das stimmt wahrscheinlich“, sagt er. Und erklärt auch, warum: „Die Bewohner von Pflegeheimen sind die, die vom Lockdown nichts haben, der direkte Effekt ist null.“ Schließlich sind sie schon weitestgehend von der Außenwelt isoliert. Die wenigen Kontakte beschränken sich auf das Pflegepersonal und gelegentliche Familienbesuche. Die sind auch mit Lockdown erlaubt. „Die anderen laufen frei herum, die sind die Treiber“, sagt Antes.
Fazit
Die Zahlen legen oft eindeutige Schlussfolgerungen nahe. Tatsächlich ist ihre Interpretation aber schwieriger als auf den ersten Blick angenommen.
Die anscheinend geringfügig mehr Toten im Jahresdurchschnitt sehen schon anders aus, wenn man die durchschnittlichen Grippetoten abzieht, die durch die Hygienemaßnahmen während der Pandemie zurückgegangen sind. Hinzu kommen aber auch andere Krankheiten, die durch das Abstandhalten, die eingeschränkten Kontakte und das häufigere Händewaschen weniger schnell übertragen werden. Auch das kann einen Einfluss haben.
Kurzum – auch mit zuverlässigen Zahlen lässt sich nicht jede These eindeutig belegen.
Eine Schlussfolgerung aber lassen die Zahlen zu: Die Senioren in den Pflegeheimen wurden offensichtlich nicht genug geschützt.