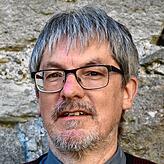Wer aus der Kirche austritt, kommt in die Schlagzeilen. Wer nicht austritt und drinbleibt, über den wird nicht geredet. Diesen Eindruck gewinnen viele Leser, die den SÜDKURIER in den vergangenen Tagen aufmerksam verfolgten. Manche Stelle lasen sie gleich zwei Mal. Umfangreich wurde über Menschen berichtet, die ihre bisherige religiöse Heimat – die katholische Kirche – verlassen haben. Die Argumente für diesen Schritt wurden respektvoll und breit ausgeleuchtet, jeder Grund war verständlich und für sich auch nachvollziehbar.
Den Schlussstein setzte dann Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitspolitiker. Er war aus der katholischen Kirche bereits vor Jahren ausgetreten, breitete seinen Exodus aber nochmals aus, in der Gewissheit: Es kann ihm nicht schaden. Er liegt damit gut im Trend.
An diesem Punkt wenden viele ein: Das stimmt nicht. Es stimmt nicht für die Tausende an engagierten, überzeugten, munteren Christen, die an Deck bleiben.
Viele bleiben mit dem Herzen drin, sagt der Pastor
Zu den Engagierten, die sich meldeten, gehört auch Wieland Bopp-Hartwig in Waldshut. Der evangelische Pfarrer an der Versöhnungskirche zählt auf, was er und seine Kollegen über Ostern alles auf die Beine stellten. Was sie seit Beginn der Ära Corona alles stemmten. Er sagt: „Ich kenne viele, die mit dem Herzen in der Kirche sind und auch bleiben wollen.“ Er ahnt, warum das so ist: „In der Kirche wird mir etwas Gutes zugesprochen, was ich sonst nicht empfangen kann.“
Manches Argumente der Kirchenflüchtigen findet er dann doch hohl. Nach dem Verbot der Segnung von Homosexuellen etwa traten vermehrt Katholiken aus. Pfarrer Bopp-Hartwig: „Wenn diese Segnung wirklich der entscheidende Faktor wäre, dann käme ja eine Mitgliedschaft in einer anderen Kirche in Frage, die solche Segnungen durchaus macht wie die Badische Landeskirche.“ Das ist aber nicht der Fall, wie er folgert. Es bleibt beim Austritt. Demnach ist der Segen eher vorgeschoben als echt.
Wo bleibt das Positive? Fragt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
Erfrischendes bringt auch Christina Leib-Kessler ein. Sie vermisst neben den notorisch schlechten auch die guten Nachrichten über Kirchliches. Sie schreibt: „Ich möchte auch einmal positive Dinge und Hoffnungsgeschichten lesen.“ Sie ist seit Jahrzehnten engagiert in der Konstanzer Altstadt. Sie kennt das Dekanat, leitet den Pfarrgemeinderat. Die Frau weiß Bescheid. Sie sagt im Gespräch: „Wer ist denn eigentlich Kirche? Das sind doch wir alle und nicht nur die, die keine Gelegenheit verpassen, Dinge zu entscheiden und zu regeln, die fernab von jeder Lebenswirklichkeit sind.“

Leib-Kessler verweist auf unzählige Initiativen, in denen das katholische Volk aus ihrem Umfeld aktiv ist. In der Familienhilfe, bei Flüchtlingen. Sie zeigt auf die Ministranten in Radolfzell, die an der Kirche St. Meinrad die Regenbogenflagge hissten.
Wir hissen die Flagge der Vielfalt, sagen die Ministranten
Das ist mutig, stellen sich die Messdiener damit doch gegen die vatikanische Anweisung (“Responsum“). Die Solidarität mit jenen Paaren, denen der Vatikan den Segen verweigert, hat für sie Vorrang. Im Pfarrgemeinderat wurde darüber breit diskutiert. Nicht alle waren mit der Aktion einverstanden. „Die Fahnenaktion hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen“, berichtet Stadtpfarrer Heinz Vogel, es wurde diskutiert.
Doch genau das wertet der Geistliche als gutes Zeichen. Die alten Zeiten, in denen im Gremium entweder einvernehmlich geschwiegen oder breit abgenickt wurde, dürften vorbei sein. Vielfalt kann auch katholisch sein.
Sie muss sich für Affären rechtfertigen, die Jahrhunderte zurückliegen
Leib-Kessler berichtet, was sie als Christin auch erfährt: „Ich spüre einen extrem hohen Rechtsfertigungsbedarf.“ In ihrem Umfeld werde sie häufig auf kirchliche Missstände hin befragt, Tendenz steigend. Dann muss sie Affären erklären, die sie nicht erklären will. Und sie muss Vorgänge, die einige Jahrhunderte zurückliegen und die vom Gegenüber als nützliche rhetorische Waffe gezückt werden, verteidigen. Die Kreuzzüge sind so eine Waffe – das Stichwort funktioniert fast immer, wenn man der Kirche auf den Leib rücken will.
Dennoch ist sie überzeugt: „Nur wer drinbleibt, kann Dinge ändern.“ Diesen Satz wird der Rentner Detlef Kaleja unterschreiben. Er ist Witwer, lebt in Waldshut. Und er steckt in einer ganz anderen Lebenssituation. Aber die Tür zuwerfen, das käme für ihn nicht in Frage.
Ich segne meine Partnerin, sagt der Witwer
Kaleja hat einen praktischen Blick auf seine Kirche. „Meiner Enkelin will ich meinen Glauben nahebringen“, sagt er. Das zähle, das sei ihm wichtig. Den öffentlichen Blick auf die katholische Kirche hält er für windschief. „Es gibt hier viele gute Dinge, moderne und gute Leute.“ Auch Ulrich Sickinger, sein Pfarrer, zählt dazu. Auf das Segensverbot hat sich Kaleja einen eigenen Reim gemacht: „Ich segne meine Partnerin.“ Das mache er einfach. Wer wolle ihm das verbieten?
Der 78-Jährige kennt seine Kirche so gut wie jeder Theologe. Er leitete den Pfarrgemeinderat in Waldshut und wirkt bis heute als Lektor und Kommunionhelfer. Sein Urteil ist verbürgt. „Wir sind als Getaufte verpflichtet.“
Ein Ortswechsel verändert vieles, erkennt der Christ im Hegau
Doch wie kommt es zur allmählichen Entfremdung der Gläubigen? Zum Beispiel so: „Nach einem meist aus beruflichen Gründen erfolgten Ortswechsel reißt die Verbindung langsam ab und verliert an Bedeutung“, beobachtet Dietmar Stephan aus Hilzingen (Hegau). Er erkennt, dass dieser Grund schwer wiegt. Ebenfalls schwer wiegen „unverständliche kirchenpolitische Entscheidungen“, die öffentlich breit abgehandelt werden. Über die vatikanischen Entscheidungen und Vergehen lässt sich immer trefflich streiten.
Doch greift das zu kurz, sagt Stephan. Er stellt die Gretchenfrage: „Wie kann ich mich selbst einbringen?“ Eine Mitgliedschaft könne sich kaum in der monatlichen Abbuchung der Kirchensteuer erschöpfen. Seine Antwort: Steh auf und tu etwas. Die nüchterne „Einsatz-Ertrags-Berechnung“ greift zu kurz. Engagement sei die richtige Antwort – nicht Davonlaufen und Abmelden.
Warum werden die Austretenden dann nicht evangelisch?
Christa Halbeisen lebt in einem Kurstift in Bad Dürrheim. Die einschlägigen Berichte im SÜDKURIER verfolgt sie mit gespannter Aufmerksamkeit. Irgendwann wurde sie ärgerlich, sie fragt: Warum wird den Abwanderern so breiter Raum gewährt? Und warum spricht niemand über die treuen Seelen, die bei Pfarrfest und Katechese stets Gewehr bei Fuß stehen – immer dann wenn‘s gilt?
Noch etwas fällt der Seniorin auf: Was mancher Katholiken an seiner Kirche vermisst oder beanstandet, ist bei den evangelischen Geschwistern längst eingelöst. Allerdings treten auch dort die Menschen aus, in Prozenten oder auch absoluten Zahlen sogar noch mehr. Die spezifisch katholischen Gründe scheint es nicht zu geben. Wenn, dann gibt es eine konfessionsübergreifende Kirchenmüdigkeit.
Ein Beispiel, das aktuell ist: Die Badische Landeskirche segnet bereits seit einigen Jahre Paare, die in gleichgeschlechtlicher Liebe verbunden sind. Und ihre Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen heiraten, auch ein zweites Mal. Damit löst die evangelisches Kirche in Baden mindestens zwei harte Forderungen ein, die an die katholische herangetragen werden. Dennoch wirft auch hier manches Mitglied die Tür ins Schloss.

Sie bleibt drin, auch wenn sie nicht glaubt, sagt die Kanzlerkandidatin
Vorhin wurde Karl Lauterbach zitiert, der über seinen Kirchenaustritt in Talkshow-konformen Sätzen sprach. Auch Annalena Baerbock wurde nach dem Thema Kirche gefragt und hatte eine andere Antwort als ihr SPD-Kollege: Sie sei kein gläubiger Mensch, sagte die Grünen-Politikerin kurz. Aber sie werde ihre evangelische Gemeinschaft nicht verlassen, weil diese ihre Kirche im sozialen Bereich enorm viel leiste. Im Herbst will die 40-Jährige Kanzlerin werden, womöglich mit dem Segen von oben.