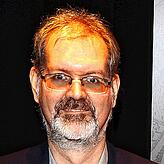Hans Betz stirbt 1453. Zu seiner Beerdigung kommen zahlreiche Würdenträger und Bürger Überlingens. Kein Wunder, denn er war ganz offensichtlich ein beliebter Bürgermeister der Stadt. Er war der eigentliche Wegbereiter des Aufschwungs der Reichsstadt Überlingen. Hans Betz hat in seiner Amtszeit zahlreiche wichtige und wegweisende Entscheidungen getroffen, die den Beginn der Blütezeit Überlingens begründeten.
„Hans Betz gebührt in den Geschichtsbüchern der Stadt eigentlich eine viel größere Bedeutung“, sagt Andre Gutmann. Der promovierte Historiker aus Freiburg referierte in der Vortragsreihe zu 1250 Jahre Überlingen über die Blütezeit der Stadt im 15. und 16. Jahrhundert. „Seine Nachfolger, wie Jakob Kessenring, sind heute deutlich bekannter.“ Hans Betz habe allerdings durch seine Entscheidungen viel mehr zum Aufschwung beigetragen.
Zahlreiche kluge Abkommen machten Überlingen erstaunlich unabhängig
In dieser Zeit wurden zahlreiche kluge Abkommen geschlossen, sodass Überlingen eine erstaunlich große Unabhängigkeit vom Königshaus erlangte. Man kaufte sich Rechte, dass unter anderem Steuern, Zollabgaben und der sogenannte Königszins in der Stadt behalten werden durften. Außerdem hatte Überlingen das Recht, eigene Münzen zu prägen. Dies führte zu einem ungeahnt gut gefüllten Stadtsäckel. Das städtische Territorium wurde deshalb extrem ausgeweitet und Überlingen weitestgehend autonom. 1479 gehörten 33 Dörfer zur Reichsstadt, wie Ahausen, Hagnau, Hohenbodman und Altheim.
Wohlstand ging auch auf Kosten der Juden in der Stadt
Allerdings zeigen die Geschichtsbücher auch, dass der Wohlstand auf Kosten der Überlinger Juden erlangt wurde. In der erzkatholischen Stadt gab es einen ausgeprägten Antijudaimus. Deshalb wurden die teils sehr reichen Juden in Überlingen enteignet und manche sogar umgebracht. „Im Sommer 1430 wurden die Juden in Überlingen ausgelöscht“, berichtet Andre Gutmann.
Kaufhaus Greth größter Warenumschlagplatz am Bodensee
Den kontinuierlichen Aufschwung hat die Reichstadt vor allem dem blühenden Handel zu verdanken. Das städtische Kaufhaus Greth galt als größter Warenumschlagplatz am Bodensee. Hier wurde hauptsächlich Getreide gehandelt. Der Großteil des Jahresumsatzes von bis zu 6300 Tonnen ging damals in die Schweiz. In der Greth wurden aber auch noch Tiere, Metall, Handwerksprodukte und auch Rebstecken verkauft. Vor allem im Weinbau war Überlingen der mit Abstand größte Produzent in der Region. Ende des 16. Jahrhunderts hatte die Stadt etwa 270 Hektar Rebfläche. In den Aufschrieben im Stadtarchiv ist zu finden, dass 1545 bis zu 34 000 Hektoliter Wein im Jahr produziert wurden. Die Haupteinnahmequellen der Stadt waren der Weinbau und den Getreidehandel.
Zahlreiche Gebäude stammen aus dieser Zeit
Ende des 15. Jahrhunderts stand die Reichsstadt in ihrer Blüte. In dieser Zeit entstanden auch zahlreiche Gebäude, die heute noch von dieser Zeit zeugen, wie beispielsweise der Ölberg (1493), der Nordturm des Münsters und das Franziskanertor (beide 1494). Auch der Rathaussaal kann auf diese Phase zurückdatiert werden. Mit zunehmender Dauer erlangte das Haus Habsburg immer größeren Einfluss in der Bodenseeregion. Überlingen reagierte darauf und schloss sich unter anderem dem Schwäbischen Bund an. Da für die Habsburger die Eidgenossen Feinde waren, geriet der Handel in Überlingen ins Stocken – und der Aufschwung wurde gestoppt, da der Handel mit den Schweizern sogar verboten wurde.

Geldmangel sorgte für 22 Jahre Zwangspause beim Bau des Münsters
Gleich zu Beginn des 16. Jahrhundert litt die Stadt bereits unter Geldmangel. Dies war beim Bau des Gallertturms und der 22-jährigen Pause beim Bau des Münsters zu erkennen. Der Wendepunkt kam 1499 mit dem Schwabenkrieg, in dem sich die Habsburger und die Eidgenossen gegenüberstanden. Mit dabei waren auch immer wieder größere Abordnungen aus Überlingen. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts war die Blütezeit endgültig vorbei und es hat sich ein stattlicher Schuldenberg in der Stadt angehäuft.
Ziert wirklich der Habsburger Löwe das Überlinger Wappen?
Aus der Anfangszeit des 16. Jahrhundert gibt es allerdings dennoch eine bemerkenswerte Entwicklung: das neue Überlinger Wappen. 1528 tauchte plötzlich ein roter Löwe mit goldenem Schwert und goldener Krone darin auf. Bislang war man davon ausgegangen, dass es sich um den Habsburger Löwen handelt. Dies stellt Andre Gutmann infrage: Ihm sei aufgefallen, dass es schon auf Überlinger Münzen aus dem 13. Jahrhundert diesen Löwen gab. Es könnte sich also durchaus um ein Wappentier der Reichsstadt handeln, zumal der Habsburger Löwe eigentlich eine blaue Krone trägt.
„Das Überlinger Stadtarchiv ist ein riesiger Schatz“
Wirkt sich die Blütezeit der Reichsstadt Überlingen bis heute aus?
Auf jeden Fall. Und das unübersehbar im Stadtbild. In dieser Zeit sind unter anderem die bis heute charakteristischen Gebäude wie Rathaus, Münster, Ölberg und Franziskaner Tor entstanden. Heute sind sie vor allem für den Tourismus von großer Bedeutung. Ich denke schon, dass die Gebäude zu Wahrzeichen geworden sind, mit denen sich die Überlinger identifizieren und die die Bürger durchaus auch selbstbewusst machen.
Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu diesem Thema?
Ich habe meine Dissertation über das Mittelalter und vor allem über den Schwabenkrieg 1499 geschrieben. Da standen sich die Eidgenossen und das Haus Habsburg, zu deren Verbündeten auch der Schwäbische Bund gehörte, gegenüber. Da Überlingen zum Schwäbischen Bund gehörte, tauchte die Stadt überall auf. Außerdem komme ich ja aus Villingen. Dort gab es einen Bürgermeister namens Jakob Betz, er muss wohl verwandt gewesen sein zum Überlinger Bürgermeister Hans Betz.
Was hat Sie bei Ihrer Forschung zur Überlinger Blütezeit am meisten überrascht?
Die grandiosen Quellen, die ganz offensichtlich noch kaum jemand bemüht hat. Das Überlinger Stadtarchiv ist voll davon. Vor allem die detaillierten Aufschriebe von Johannes Mecker, der zwischen 1470 und 1494 Stadtschreiber war, sind unglaublich informationsreich. Dort erfährt man vor allem auch ungewöhnliche Sachen, wie Inhalte einer Kaufhausordnung und Produktionsmengen von Wein. Das Überlinger Stadtarchiv ist ein riesiger Schatz.