A wie Alefanz
Dieses mysteriöse Wesen ist im alemannischen Raum weit verbreitet und eine Grundeigenschaft für jeden wahren Narren. Dem Alemannen stellt sich allerdings zuerst einmal die Frage, wie so oft, wenn es um den Dialekt geht, schreibt man ihn nun mit einem L „Alefanz“ oder mit zwei „Allefanz“? Als Überlinger bevorzugt man die zweite Form mit Doppel-L. Also wär‘s hier allefänzig, das ist das Adjektiv, wenn einer deshalb auf dem einen einzigen L beharrt. Weil er dann wider den Stachel löckt, die Mehrheit spottet, nur um des Widerspruchs willen. Bessere Erklärungen? Ein Obernarr definierte es mal so: „Allefänzig isch, wenn onner itt so due hot, wie en andere gmonnt hott, dass de sell hett wette sotte.“ Übersetzt: „… wenn einer nicht so handelte, wie ein anderer meinte, dass jener hätte handeln sollen wollen.“ Gut, für die Gelehrten unter uns sei angemerkt, dass Lexers mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, jedem Germanisten aus dem Studium wohlbekannt, unter dem Lemma „alevanz“ (mit einem L) zu übersetzen ist mit „aus der Fremde gekommener, hergelaufener Schalk“ oder als Substantiv „Possen, Schalkheit, Betrug, Geschenk“.

B wie Brezele
Das Brezele gehört in Überlingen wie vielerorts in der schwäbisch-alemannischen Fasnet dazu. Der Hänsele fädelt sich mehrere auf seine Karbatsche auf, um sie an Zuschauer und andere Mäschgerle auszugeben. Denn wie heißt es so schön in der Etikette, die er zu befolgen hat: Der Überlinger Hänsele ist ein „gebender Narr“. Vielleicht noch übertroffen von Freigiebigkeit der Narrenfreunden aus Oberndorf, mit denen man sich zusammen mit Rottweil und Elzach alle drei oder vier Jahre im berühmten „Viererbund“ zum Narrentag trifft. Und genau da kommt die Brezel ins Spiel, die viel dazu beitrug, dass dieser Viererbund entstand. Ein Hauptgrund für die „Rebellenzünfte“, sich in den 1950-er Jahren von der „Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte“ (VSAN) loszusagen, war die Respektlosigkeit, mit der viele nach dem zweiten Weltkrieg wie Pilze aus dem Boden schießenden neuen Narrenvereine die Kleider, Häser, Masken und Attribute abkupferten – ohne dass die VSAN etwas dagegen getan hätte. Kopiert wurde auch die bis dahin – laut Oberndorf – einmalige Brezelstange des Oberndorfer Narro, auf die er sein Laugengebäck auffädelt. Übrigens: Um die Entstehung des „Brezeles“ – der Alemanne liebt den Diminutiv – ranken sich viele Legenden. Wohlbekannt ist jene, die von der Forderung eines Fürsten erzählt, der ein Gebäck verlangte, durch das die Sonne dreimal scheint. Tatsächlich ist die Brezel aber mit ziemlicher Sicherheit im Umfeld der Klöster als reines Fastengebäck entstanden: „Bracellum“ heißt auf Lateinisch „Ärmchen“ und nimmt das Motiv der brezelartig vor der Brust gekreuzten Arme auf – vor den gefalteten Händen die typische Gebetshaltung. Über die Form „brezzitella“ floss es in die deutsche Sprache.

C wie Corona – oder Chaise?
Ja, es könnte einem jetzt in den Sinn kommen, dass in einem 2021-er Überlinger Fastnachts-ABC unter C „Corona“ stehen müsste, als größter Narreteiverhinderer seit der Pest, die in der freien Reichsstadt viele Male wütete. Doch ein alefänziger Überlinger würde sagen: „Dued dem Virus itt z‘vill Ehr aa.“ Indes lehrt einen der dadurch eröffnete Blick in die Geschichte, wie die Menschen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit nach dem Ende der damaligen Pandemien wieder Hoffnung schöpften und bald wieder ausgelassen Fastnacht feierten. Im Übrigen muss jeder, der in Überlingen in der Fastnacht unterwegs ist, wissen, was eine Chaise ist – auf Alemannisch wird die Kutsche auch „Schese“ genannt: In ihr, einem Landauer, traditionell von Pferden gezogen, sitzen die Narreneltern.
D wie Dorfer
Beim Dorferfrühschoppen sind die Männer unter sich und das ist gut so. Denn genauso geht es da auch zu, wenn die Redner in die Butte steigen. Richtig deftig. Da gibt es originelle, viel beklatschte Büttenredner, die alle Jahre neue Tiefen auf der nach unten offenen Dorferskala ausloten, wie einmal ein SÜDKURIER-Berichterstatter schrieb. Und es gibt in der Dorferbutte geniale Redner, die messerscharf geschliffene Verse geschmiedet haben. Legendär, weil längst nicht mehr aktiv: Bürgermeister Reinhard Ebersbach als Nachtwächter. Frauen haben nur als Personal oder Musikerinnen Zutritt. Ein alljährlicher Widerspruch: Der Dorfer heißt so, obwohl er seine Bühne unten in der Stadt hat, in „Krone“ und „Galgenhölzle“, die zu diesem Zweck eine sonst übers Jahr vorhandene Trennwand entfernen. Der Name erinnert an die Entstehung im Stadtteil „Dorf“, von dort zog er vor bald einem Vierteljahrhundert vom „Bürgerbräu“ um in die Stadtmitte.

E wie Einschnellen
Da könnte das E gleichzeitig auch für „Epiphania“ stehen, denn die Fastnacht wird eingeschnellt am Erscheinungstag des Herrn, heute gemeinhin als Dreikönigstag bekannt. Am 6. Januar beginnt die schwäbisch-alemannische Fastnacht und in Überlingen ist dieser Feiertag für alle Narren ein eigenes Hochfest. Schlag 12 Uhr vom Münster geht das Spektakel in der Münsterstraße vor der Münstertreppe los, auf der sich die „Dampfkapelle“ aufgestellt hat und den Narrenmarsch in Schleife spielt. Männer und immer öfter auch mal Frauen zeigen ihre Kunstfertigkeit mit der kurzstieligen Hanfpeitsche, deren drei, vier Meter lange konisch zulaufende geflochtene Strick rhythmisch zum Knallen gebracht wird – als Konzert aus drei, fünf oder sieben Schnellern. Narren- und Hänseleräte tragen ihre Narrenkappen, andere vielleicht eine Kappe in badischen Farben. Ansonsten ist die still vereinbarte Kleiderordnung: Zivil. Der Tag klingt aus im gegenüber der Münstertreppe liegenden „Galgenhölzle“, in dem Tag bisweilen erst am anderen Morgen endet.

F wie Fazenetle
So sagt der Alemanne zu seinem Schnupftuch. Und weil das aus der Hosen- oder Jackentasche hängende Fazenetle früher als Zeichen für einen ungehobelten Zeitgenossen galt, einen der wenig von guten Sitten hielt, sieht man es – als Attribut des Narren als Außenseiter – oft heute noch in der Fasnet in dieser Art getragen, in seiner bäuerlichen Gestaltung als rot-weiß gemustertes riesiges Taschentuch. In seiner eleganten, reinweißen Form gehört zu dem in seinem Erscheinungsbild streng reglementierten Überlinger Hänsele, der es an der Brust herabhängend trägt. Und den Narrenräten „lampet“ es, so heißt das im Dialekt, ebenfalls in weiß, aus der rechten Scheintasche ihres blauen Biedermeiermantels.
G wie Guggemusik
Als diese Schweizer Variante dieser fastnachtlichen Musikkapellen Ende der 1950-er Jahren zuerst am Hochrhein die Grenze überwanden, wurden sie von den Traditionswahrern im schwäbisch-alemannischen Raum äußerst misstrauisch beäugt. Das galt besonders für Überlingen noch für die 1980-er Jahre. Nach und nach freundete man sich auch in Überlingen mit den schrägen, rhythmischen Blasmusikklängen an. In der ehemals freien Reichsstadt leisteten diesbezüglich einige Guggenmusiken aus der Region Pionierdienste, vor allem die positiv aufgenommene Gastauftritte etwa der Stockacher „Yetis“, die sich 1987 gegründet hatten und damit eine der frühen Guggen rund um den Bodensee sind. 1998 dann bildete sich die erste echte Überlinger Guggemusik, die „Seegumper“, die heute aus der Überlinger Fastnacht nicht mehr wegzudenken ist. Ebensowenig wie die „GuggeVamps“, die sich 2005 aus einer Lehrerweckgruppe entstanden.

H wie Hänsele
Als erstes sei geklärt, es heißt männlich „der Hänsele“, wenn ein Kerle drinsteckt, und sächlich „das Hänsele“, wenn das Häs leblos überm Kleiderbügel hängt. Der Überlinger Hänsele gehört zu den ältesten Fasnachtsfiguren im schwäbisch-alemannischen Raum. Er ist, wie etwa der Rottweiler „Federahannes“, der Gruppe der Teufelsfiguren zuzuordnen. Solche Gestalten dienten im Mittelalter bei kirchlichen Spielen oder Prozessionen dazu, die Gläubigen mahnend an den Leibhaftigen zu erinnern. Eine in Ratsprotokollen erhaltene „Fasnachtsordnung“, entstanden zwischen 1496 und 1518, forderte die Überlinger auf, das „Düfelshäs“, das sie zur Fasnacht von den Pflegern der St. Nikolauspfarrei ausgeliehen hatten, später wieder zurück zu geben – und sollten sie sich ein eigens gemacht haben, das der Kirche unterm Jahr zu überlassen. Die mittelalterliche Figur des Narren, der in sich Gottesleugner, Teufel und Tod vereinigt, wird im Hänsele idealtypisch tradiert. Das zeigt sich kurioserweise fernab der Fasnet, am zweiten Sonntag im Juli, beim „Schwerttanz“ der Zunft der Überlinger Rebleute. Dieser frühere Fasnachtsbrauch wurde im 19. Jahrhundert aus der Fastnacht herausgenommen und ist seither Bestandteil der Marien verehrenden „Schwedenprozession“. Und während im Münster die Wandlung stattfindet, stehen die Türen des Gotteshauses auf und – nun mitten im Sommer – schnellt ein Hänsele mit der Karbatsche gegen die heilige Handlung an. Hier seien gut 700 Jahre abendländischer Geistesgeschichte ins heute tradiert, sagte der als der „Fastnachtsprofessor“ bekannte Volkskundler Professor Dr. Werner Mezger im Jahr 2001 in seiner Dankesrede nach der Verleihung des Bodenseeliteraturpreis der Stadt Überlingen, den er für sein „Grosses Buch der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht“ erhielt. Im Jahr 2020 waren 1561 erwachsene Männer in die Mitgliederlisten der Hänselezunft eingetragen. Mitglied kann nur werden, wer volljährig ist, sein Lebensumfeld in Überlingen hat, Karbatschen schnellen kann und dessen Häs von einer Kommission geprüft ist. Überlinger Buben wachsen in die Tradition, indem sie sich ihre Kinderhänsele von der Narrenzunft ausleihen, die die Dachorganisation ist, zu der auch die Hänselezunft gehört.

I wie „itte“
Das alemannische „nicht“ oder „bitte nicht“. Spontaner Ausruf frisch frisierter Damen, wenn der Hänsele ihr beim Schnurre die Haare durchwühlt. Oder auch bekannt aus dem Standardstatz des Hänsele oder voll vermummter Mäschgerle, die ihn mit verstellter Stimme fragen: „Gell, du kennsch mi itt?“ – Du kennst mich nicht, stimmt‘s?

J wie Juhu!
Juhu! – Das ist der Überlinger Narrenruf, den man selbst jetzt, in Corona-Zeiten, allerorten hört. Er ist ein „Juchzger“, ein Freudenschrei aus tiefster Brust und Seele. „Narri Narro“, „Ho Narro“ oder andere Narrenrufe sind in der Stadt verpönt. Das gilt allerdings nicht für die der anderen drei Viererbundstädte. Das „TrallaHo“ aus Elzach, das Hu-Hu-Hu aus Rottweil oder das Juhuhu aus Oberndorf, wo man aber auch das „O jerom“ als Beginn des wehmütigen Narrenmarsches gerne als Ruf verwendet.
K wie Karbatsche
Die Karbatsche ist die zwischen drei und fünf Meter lange aus Hanf geflochtene Peitsche an einem 30 Zentimeter langen Holzstiel, die der Hänsele über den Kopf schwingt. Sie zu beherrschen und einen infernalisch lauten Knall zu erzeugen, bedarf ebenso Kraft wie Übung. Die Karbatsche findet sich als Fasnachtspeitsche in Regionen Linzgau, Bodensee und Oberschwaben. Ihr Name lässt sich vom türkischen „Gyrbatsch“, dem ungarischen „Koràcs“ und dem tschechischen „Karabac“ herleiten. Höchstwahrscheinlich kam sie über die einst vorderösterreichischen Gebiete in der Region an den Bodensee. Erstmals in einem Ratsprotokoll erwähnt wird die Karbatsche 1789. Wie die heute noch bei den ungarischen Hirten hoch zu Pferde geschwungene Reiterpeitsche war auch die Überlinger Karbatsche bis 1900 aus Leder geflochten, einige wenige solche Exemplare sind erhalten.

L wie Löwe
Hinter diesem L versteckt sich das Überlinger Fastnetshäs speziell für Frauen. „Der Überlinger Löwe“, so heißt der Verein, wurde 1995 gegründet als Antwort der Überlingerinnen auf den Hänsele, der traditionell ein reines Männerkostüm ist – was die Überlinger Damenwelt aber als gewachsenes Brauchtum selbstverständlich akzeptiert. Aber in einem eigenen Häs Fasnet machen wollten sie eben auch. Der Löwe orientiert sich an der entsprechenden Tierfigur im Oberwappen des 1528 durch Kaiser Karl V. verliehenen „gebesserten Wappens“ der ehemals freien Reichsstadt – es ist übrigens das wohl einzige deutsche Kommunalwappen mit Oberwappen. Der Löwe trägt einen roten Fransenanzug, das Stadtwappen auf der Brust. Das Gesicht ist hinter einer geschnitzten Löwenmaske verborgen, die von einer riesigen Mähne gekrönt wird. In der Hand ein Holzschwert, das auch der rote Löwe im Wappen in den Klauen hält.
M wie Mäschgerle
Das Mäschgerle ist jede originelle Verkleidung, in der ein kleiner oder größerer Narr steckt. Im Regelfall meint der Überlinger damit jedes Kostüm, das kein Hänsele aber phantasievoll ist.
N wie Narreneltern
Die Narrenzunft Überlingen hat keinen Zunftmeister, wie es quer durch den süddeutschen Raum üblich ist, sondern Narreneltern, die als Besonderheit des Bodenseeraums gelten. Der ältere Teil der Narreneltern ist die Narrenmutter, die ein bereits im Mittelalter bekanntes Motiv darstellt. Die Volkskunde sieht sie durch Eva inspiriert, die nach dem Sündenfall die Narrheit und Gottesferne über die Menschheit gebracht hat. Immer wieder wird sie mit sieben Söhnen in Verbindung gebracht, die für die sieben Hauptsünden stehen. Berühmt ist die entsprechende Darstellung auf dem „Ambraser Zierteller“ in der Wunderkammer von Schloß Ambras bei Innsbruck. In der Tracht der Narrenmutter steckt in der verkehrten Welt der Fastnacht natürlich ein Mann. Narrenmutter und Narrenvater als Paar sind in Überlingern seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentiert. Sie sind gleichzeitig die von der Narrenzunft gewählten beiden Vorsitzenden des Organisationskomittees der Überlinger Fasnet, der Narrenzunft, das im Regelfall um die 40 bis 45 Mitglieder hat. Einen Zunftmeister hatte Überlingen nur einmal, kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Die französischen Besatzer wollten einen einzigen Ansprechpartner und so wurde diese Position temporär geschaffen, Inne hatte sie der legendäre Erznarr Victor Mezger jun.

O wie Organisation der Fastnacht
Die Organisation der Überlinger Fasnet liegt in den Händen der Narrenzunft. Dieses Festkomitee hat nichts mit einem Elferrat zu tun. Derzeit besteht es aus etwa 45 Mitgliedern. Die Zahl schwankt, je nachdem, wie viele Zunftgesellen neu aufgenommen werden und wie viele alte Räte aus Altersgründen ausscheiden oder sterben. Selten hört einer wegen Wegzug oder aus beruflichen oder anderen Gründen früher auf. Zum Narrenrat kann man sich nicht bewerben, man wird gefragt und übernimmt die Position auf Lebenszeit. Die Hänselezunft ist eine Abteilung der Narrenzunft, die in ihr durch den Hänselevorstand aus Hänseleräten vertreten wird. Neben der Hänselezunft gehört auch die Zimmermannsgilde zum Gesamtverein.

P wie Plämper
Es gibt zwei Arten von Plämpern. Einmal Plaketten und Abzeichen, die man käuflich erwerben kann, alle Jahre neu gestaltet und gerne gesammelt. Dann die Orden, die alleine von der Narrenmutter vergeben werden. Sie, und sonst niemand, verleiht das begehrten Blechle nach eigener Entscheidung. Im Gegensatz zu anderen Städten, die sich strenge Ordenssatzungen gegeben haben, hat der Narrenplämper sich hier also noch ein bisschen von seinem Ursprung bewahrt: Verballhornung der tatsächlichen staatlichen Orden zu sein.

Q wie Quälgeischd
Das Isch onner, der om tiersisch uff de Sack goht, weil er ko Fasnet macht.

R wie Rollen
Das hat jetzt nichts mit umherpurzeln zu tun, was bisweilen eine Nebenwirkung des Genusses von Seewein sein soll. Die Rollen werden mit einem kurzen „e“ am Ende gesprochen. Sie sind die Glocken am Hänsele, weil es kugelförmigen Schellen mit einem Schlitz sind und keine nach unten offenen Glocken wie jene im Kirchturm – wobei sich auch diese Form an Narrenkleidern findet, etwa in der Tiroler Fastnacht. Kleine Göcken in ihren verschiedenen Formen gehört zu den ältesten Narrenattributen, die sich auf Gemälden und Stichen schon an den Kleidern mittelalterlichen Standardnarren finden. In ihrem hellen Geläut schwingt die Disharmonie der irdischen Welt mit. Die Wissenschaft ist sich heute einig, auch mit Blick auf erhaltene mittelalterliche Predigten, dass die Schelle auf 1. Korinther 13 verweist, das „Hohelied der Liebe“: „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.“ Wer also die Caritas nicht besitzt, ist nur zu disharmonischen Klängen fähig, nicht zur Harmonie mit der Gott zugewandten Welt.

S wie Schnurrer
Zuschauer oder andere Mäschgerle „aaschnurre“, das gehört zum Hänsele dazu. Weil er ein „gebender Narr“ ist, hat das bei ihm nichts mit Heischen zu tun, sondern läuft ab wie in Rottweil das „Aufsagen“ oder in Villingen das „Strählen“. Also jemandem im kurzen Gespräch grobgünstig die Leviten lesen, ihn necken, mit ihm monologisch oder dialogisch Schabernack treiben. Nach wie vor sind in der Stadt aber auch noch einzelne Schnurrer oder Schnurrergruppen unterwegs, die durch die Lokale ziehen und sich ein phantasievolles Motto überlegt haben. Doch immer mehr Gastronomiebetriebe sind über Fastnacht geschlossen und die anderen Kneipen dann überfüllt. So gibt es für Schnurrer oder Schnurrergruppen kein Durchkommen mehr und der Brauch immer weniger gepflegt.

T wie das T in Fastnacht
Ja, die Sache mit dem T. Heißt es nun Fasnacht oder Fastnacht oder Fasnet? In Überlingen benutzen die Einheimischen Letzteres. Fasnet heißt die fünfte Jahreszeit im Dialekt. Und wenn man hochdeutsch schreibt, dann – ja, dann sollte man Fastnacht immer mit T schreiben. Zwar wurde die närrische Zeit in den vergangenen Jahrhunderten auch mal ohne T geschrieben, schließlich war die deutsche Sprache vor Konrad Duden nicht normiert. Doch in der Regel wurde es mit T als Fastnacht geschrieben, weil es um die Nacht vor der Fastenzeit geht. Doch die Nationalsozialisten wollten genau diesen Ursprung auslöschen, um den Ursprung des wilden Narrentreibens in germanischen Urzeiten zu verorten. Zur eigenen Legitimation wollten die Nazis alles deutsche Brauchtum direkt aus dem Germanentum herleiten, dazu diente vor allem die süddeutsche Fastnacht. Die Volkskunde spricht heute von „Kontinuitätsprämisse“. Zur Strategie, die christlichen Wurzeln auszublenden, gehörte auch die Schreibweise „Fasnacht“, die – nachweislich – vor allem ein Volkskundler betrieb: SS-Untersturmführer Dr. Hans Strobel (1911 bis 1944), seit 1941 Leiter des Amtes „Volkskunde und Feiergestaltung“ im „Amt Rosenberg“. Bereits 1933 hatte Strobel sich, in seinem Versuch, die christlichen Grundlagen von Fastnacht und Brauchtum insgesamt zu negieren, einen wüsten Streit mit dem Münchner Erzbischof Michael Kardinal von Faulhaber geliefert. Gerade in Überlingen, wo die christlichen Wurzeln des Hänsele so durch die Quellen offenbar sind, muss deshalb die Devise sein: Das T bleibt drin.

U wie Ueberlingen = Überlingen
Bis ins 20. Jahrhundert wurde der Name der Stadt ohne Umlaut geschrieben. Jetzt gerade auf der Absetzungsurkunde der Narrenzunft, die Oberbürgermeister Jan Zeitler am Schmotzigen Dunschdig zugestellt worden ist. Wo immer einem in alten Aufzeichnungen der Name deshalb mit Ue begegnet, leuchtet ein bisschen Herrlichkeit der Vergangenheit durch, denn die Schreibweise erinnert an die Zeiten, als Ueberlingen freien Reichsstadt war. Und der trauern viele Überlinger bis heute ebenso nach wie dem Status als Kreisstadt, der mit der Kreisreform 1973 endete. In der Fastnacht bricht sich das alte Selbstbewussten dann immer wieder Bahn, in der närrischen Zeit wird das Badnerlied noch ein bisschen inbrünstiger gesungen als sonst. Immerhin, seit 2020 gibt es, nach langem Kampf, der viele Male Thema in der Fastnacht war, wieder das ÜB als Autokennzeichen.
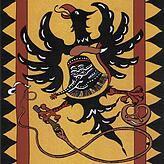
V wie Viererbund
Innerhalb der 1924 gegründeten „Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte“ (VSAN) nahmen nach dem zweiten Weltkrieg die Auseinandersetzungen über die Wahrung der Traditionen stetig zu und führten 1952 zum offenen Bruch. Einige alten Zünfte mit langer Herleitung ihres Brauchtums entdeckten eine Verwässerung der Überlieferungen, auch durch die zahlreichen Zunft-Neugründungen nach dem Krieg, die Traditionskleider und Masken schamlos kopierten. Der Überlinger Ehrenzunftmeister Viktor Mezger jun. prägte den Ausdruck der „Hudelware“ für lieblose Kostüme, deren Träger sie nur als Freibrief für zügelloses Feiern sahen. Auch die überhand nehmenden Narrentreffen wurden beklagt. 1953 traten dann die großen und berühmten Traditionszünfte Rottweil, Elzach und Überlingen aus der VSAN aus. 1955 folgte die Historische Narrozunft Villingen, dort war bis zu diesem Zeitpunkt sogar der Sitz der VSAN gewesen. Villingen entschied sich, fortan nur noch in den Mauern der eigenen Zähringerstadt aufzutreten. Die anderen drei abtrünnigen Zünfte, zu denen 1958 die Narrenzunft Oberndorf stieß, fanden sich 1963 zum „Viererbund“ zusammen, der schon zuvor eigene Treffen reihum in den Städten organisiert hatte. Seither funktioniert der nur durch Handschlag, ohne Satzung, besiegelte Viererbund als Vereinigung der „Rebellenzünfte“ oder „Narrenaristokraten“. Der Begriff „Narrenaristokraten“ für den Viererbund wird Kurt-Georg Kiesinger zugeschrieben, dem einstigen Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten und späteren Bundeskanzler, der das durchaus süffisant meinte. Narrentage des Viererbundes: 1958 Überlingen, 1959 Elzach, 1960 Rottweil, 1963 Überlingen, 1966 Oberndorf, 1969 Elzach, 1973 Rottweil, 1977 Überlingen, 1980 Oberndorf, 1984 Elzach, 1987 Rottweil, 1992 Überlingen, 1995 Oberndorf, 1999 Elzach, 2003 Rottweil, 2006 Überlingen, 2010 Oberndorf, 2013 Elzach, 2016 Rottweil, 2020 Überlingen.

W wie Wieber, alte
Nein, in Überlingen ist der Ausdruck „Wieber“, Weiber, für Frauen nicht despektierlich gemeint. Die Fasnachtsgruppe der „Alten Wieber“, 1983 von Frauen für Frauen gegründet, ist hoch geachtet. Das Häs des Alten Wiebes wurde schon früher von weiblichen Schnurrergruppen gerne getragen. Es besteht aus einem weißen knöchellangen Unterrock mit weißer Spitze, einem schwarzen ebensolangen Rock, weißer Spitzenbluse, Jacke in gedeckter Farbe, Pelz-Pelerine, schwarzen Schnürstiefeln, Schirm, Tasche, Korb und einem zum Kostüm passenden Hut. Die liebevoll gestalteten Häser, die sich an Frauenkleider des 19. Jahrhunderts anlehnen, sind aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Und fanden auch international schon Beachtung: 2000 holten sich die Alten Wieber beim „Euro Carneval“ in Venedig einen „Goldenen Löwen“.

X wie Xell
Der Zunftxell ist der in die Narrenzunft aufgenommene Nachwuchs, der nach entsprechenden Verdiensten in den Stand eines Narrenrates erhoben wird. Dieser Xell hat aber nichts zu tun mit dem Xelleball, den es früher, vor Jahrzehnten, an der Fastnacht gab. Sein Niedergang steht dafür, dass die Zeit der klassischen, glanzvollen Fastnachtsbälle der Vergangenheit angehört.

Y wie Yach
Doch, es gibt ein Ypsilon-Wort, das mit der Überlinger Fasnet etwas zu tun hat. Yach, gesprochen „I-jach“, ist der einzige Ort in Deutschland, der mit einem Ypsilon beginnt, und ein Stadtteil der befreundeten Viererbundstadt Elzach. Und so, für viele Überlinger ein Begriff, die das 1974 eingemeindete Dorf durch regelmäßige Besuche der Viererbund-Narrentage in Elzach oder der alljährlichen Fastnacht dort kennen. Die Elzacher Fastnacht nämlich ist – mindestens aus eigener und Überlinger Sicht – die beeindruckendste im ganzen Schwarzwald. Yacher wohnen in einer der Gemeinden des alten Kirchspiels Elzach und haben deshalb das Privileg, in den Schuttig gehen zu dürfen. Und bei Narrentagen gibt es dort auch Quartiere für die Narrenfreunde aus den anderen Städten.

Z wie Zimmermannsgilde
Sie ist eine Abteilung der Narrenzunft, 1952 gegründet. Sie ist ist für das Fällen, das Räpeln (Schälen), den Transport und vor allen Dingen für das schwierige traditionelle Stellen des Narrenbaumes am Schmotzigen Dunschtig verantwortlich. Viele Mitglieder, die alle die traditionelle Kluft des Zimmermannshandwerks tragen, sind auch im wirklichen Leben Zimmerleute.














