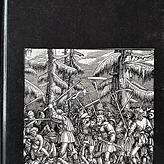Herr Priebe, was hat Sie bewegt, ein Buch über die Schlacht vom Rafzerfeld zu schreiben?
Carsten Priebe: Die Ereignisse, die sich vor unserer Haustüre vor 500 Jahren abgespielt haben, darf man nicht unerwähnt lassen. Leider gibt es kaum Quellen für die letzte Schlacht des Bauernkriegs, die mit der totalen Niederlage der Bauern und damit auch dem Ende der freiheitlichen Bestrebungen endete.
Dadurch war die Herrschaft des Adels in Deutschland bis ins Jahr 1918 manifestiert. Das Thema Bauernkrieg ist im Augenblick in aller Munde, wird aber in Rafz nicht thematisiert, obwohl hier diese letzte Schlacht stattgefunden hat. Mit meinem Buch versuche ich eine Lücke im Narrativ zu schließen.
Wie ist es Ihnen gelungen, bisher verborgene Quellen zu erschließen?
Carsten Priebe: Zunächst möchte ich betonen, dass ich hier kein Buch, das wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, geschrieben habe, sondern ein Sachbuch. Insofern habe ich die bekannten Quellen – historische Lexika der Schweiz und diverse Bücher – herangezogen, Recherche vor Ort betrieben und mich dann der Lebenswirklichkeit der Menschen vor 500 Jahren angenähert.
Was bedeutet das konkret?
Carsten Priebe: Die Bauern der damaligen Zeit waren kräftige Burschen, die harte, körperliche Arbeit gewohnt waren, doch die Repressalien durch die Obrigkeit nicht länger hinnehmen wollten. Vor 500 Jahren hatte Luther seine 95 Thesen veröffentlicht, die Reformation und damit auch freiheitliche Ideen brachen über das Land herein.
Das wiederum bedeutete einen Angriff auf die katholische Kirche, die sich in ihrer Macht bedroht sah. Der Ausgangspunkt des Bauernkriegs war der Aufstand in Stühlingen, wo der Graf von Lupfen den Frondienst verschärfte. Unter anderem forderte er von den Bauern, die Hecken zu schneiden, um die Jagdmöglichkeiten für die Obrigkeit zu verbessern.
Sie erwähnen auch die zwölf Artikel von Memmingen. Was hat es damit auf sich?
Carsten Priebe: Die Artikel gelten bis heute als eines der ersten schriftlich fixierten Programme einer revolutionären Bewegung in Europa und wurden schnell zu einem Grundlagentext für die Aufstandsbewegungen des Bauernkriegs. Sie gelten als Antwort auf die empfundenen Missstände, mit dem Ziel, die alten Rechte der Bauern wiederherzustellen.
Was fordern die Bauern in den Artikeln?
Carsten Priebe: Der erste Artikel fordert eine freie Wahl des Pfarrers, dessen Aufgabe es sei, das Evangelium zu predigen und keine menschlichen Gebote. Ferner forderten die Bauern einen Zugang zu Wild und Fisch. Das heißt, das Jagdrecht sollte nicht nur dem Adel vorbehalten bleiben. Auch die Nutzung des Holzes aus dem Wald sollte für die Bauern problemlos möglich sein. Ferner wurde gefordert, die Abgaben und Frondienste auf ein angemessenes Maß zu reduzieren.
Zurück nach Rafz. Wie muss man sich die Abläufe der Schlacht vorstellen?
Carsten Priebe: Die Schlacht im Rafzerfeld war die letzte Ritterschlacht, die ohne den Einsatz von Feuerwaffen geschlagen wurde. Es war also ein direkter Kampf, Mann gegen Mann. Außerdem ein ziemlich ungleicher Kampf. Nach der entscheidenden Niederlage der Bauern bei Frankenhausen in Thüringen waren die Bauern geschwächt.
Durch die Gefangennahme und Hinrichtung von Thomas Müntzer ist der Widerstand der Bauern weitgehend gebrochen. Dennoch gelang es dem Bauernführer Klaus Wagner aus Grießen noch einmal ein Heer aufzustellen, das sich am 4. November dem Habsburger Ritterheer unter Christoph Fuchs von Fuchsberg entgegenstellte.
Der Kampf war aber aussichtslos …
800, mit Gabeln und Sensen bewaffnete Bauern gegen 500 Ritter und 1000 Landsknechte machten die Sache zu einer klaren Angelegenheit. Es war ein brutales Gemetzel. Die Bauern, die flüchten konnten, wurden später in Grießen gefangen genommen und zum großen Teil erschlagen oder hingerichtet.
Was waren die Auswirkungen?
Carsten Priebe: Nach der Schlacht hat Zürich seinen Einfluss in der Grenzregion stärken können. Das Rafzer Feld, bis dahin im Besitz der Klettgauer Grafen, gelangte ein Jahrhundert später ganz an den Kanton Zürich, ein Teil des oberen Klettgaus an die Stadt Schaffhausen. Als Folge des Bauernkriegs hat sich die Täuferbewegung in Schleitheim etabliert.
Und was hat es mit Thomas Müntzer auf sich?
Carsten Priebe: Thomas Müntzer war ein Theologe, der die Ideen Luthers unterstützte, sich jedoch in seiner Radikalität nicht nur gegen das Papsttum, sondern auch gegen die weltliche Ordnung stellte. Er gilt als Leitfigur des Bauernkriegs in Thüringen, soll sich aber von Dezember 1524 bis Februar 1525 in Grießen aufgehalten haben, wo er zu Gast bei Klaus Wagner war.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Müntzer in der damaligen Zeit ohne Verkehrswege von Thüringen nach Grießen gelaufen ist und dann wieder dorthin zurückkehrte. Eine ganz schräge Sache ist die Figur Thomas Müntzer in der DDR, wo er als Theologe als Nationalheiliger verehrt wurde und sogar auf dem 5-Mark-Schein der DDR abgebildet war.