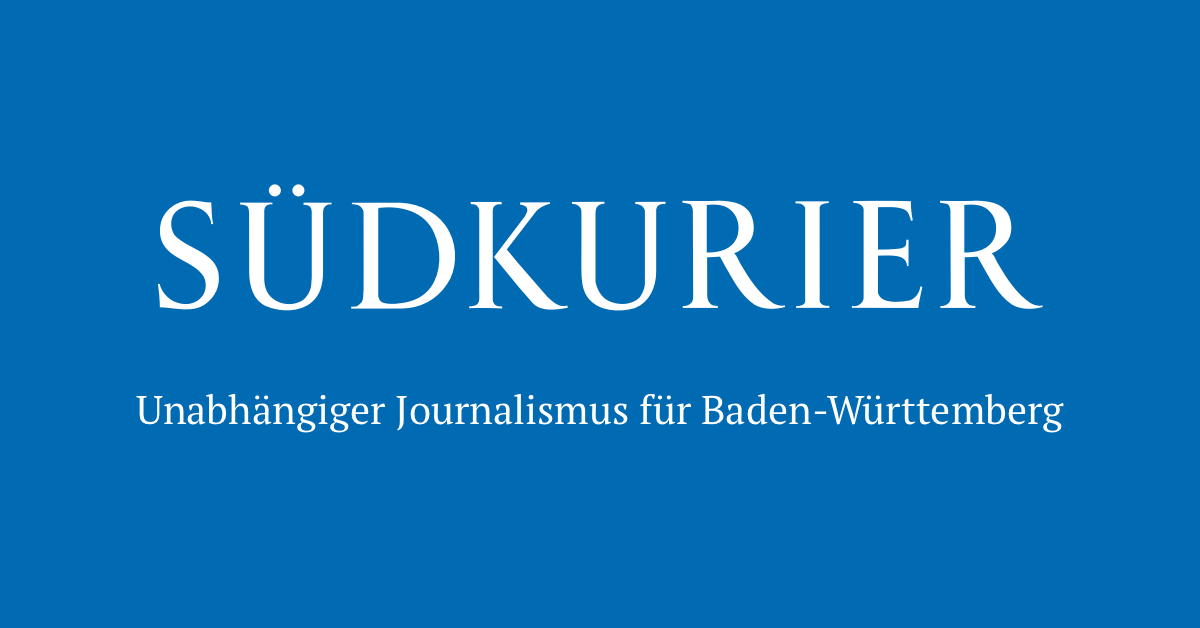Was lange währt, wird nicht zwingend gut. Rund vier Jahre dauerte es, Lärmschleppen des Flugbetriebs am Euroairport (EAP) zu untersuchen. Ende 2016 legte Letzterer die Ergebnisse schließlich der trinationalen Umweltkommission vor. Die Bewertung aber bleibt kontrovers. Während der EAP keine „erheblich weiterführenden“ Erkenntnisse sieht, die Verallgemeinerung ablehnt und auf Dialog mit den Bürgerinitiativen setzt, monieren diese Defizite der Studie, sehen Belege, dass die Belastung höher ist als angenommen, und fordern die periodische Erfassung der Daten, teilt die Bürgerinitiative südbadischer Flughafenanrainer mit.
Die Geschichte beginnt 2012. Damals beschloss die trinationale Umweltkommission, den Austausch zwischen den Bürgerinitiativen und der Direktion des Flughafens zu intensivieren. Infolge entstand eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Anrainerverbände aus der Nordwestschweiz, dem Südelsass und der Bürgerinitiative südbadischer Flughafenanrainer (BISF) auf der einen sowie Vertretern des Flughafens und der französischen Zivilluftfahrtbehörde auf der anderen Seite.
Diese wiederum einigte sich auf eine Analyse der Lärmschleppen zu wichtigen Navigationspunkten der An- und Abflugverfahren am Euroairport, darunter der bei Kandern gelegene Anflugpunkt Elbeg, den knapp 40 Prozent der auf der Nord-Südpiste startenden Maschinen in einer 270-Grad-Kurve über Allschwil und das Elsass anfliegen.
Dieses Projekt verbindet mehrere Absichten: Zum einen ging es darum, eine Karte des realen, am Boden ankommenden Fluglärms zu erstellen; zum anderen war es auch ein Ziel, Konflikte um Lärmbelastungen am Flughafen auf einer niedrigen Eskalationsstufe zu identifizieren und möglichst dialogisch zu lösen. Nun aber entpuppt sich der Ansatz seinerseits als Quelle für Konfrontation, habe gar das Potenzial zur „bisher größten misstrauensbildenden Maßnahme des Flughafens gegenüber den Anrainern“, heißt es in der Mitteilung der BISF.
Ein erster Dissens offenbart sich da bereits in der Interpretation des Untersuchungsauftrags: Während der EAP da nur mehr von einer Machbarkeitsstudie zur Modellierung der Lärmschleppen spricht, betrachtet die BISF das bereits als Umdefinition der ursprünglichen Intention und moniert weiterhin eine umfassende Analyse dieser Lärmschleppen, wie sie zum Beispiel am Frankfurter Flughafen gemacht wurde.
Im Endeffekt verständigte sich die Arbeitsgruppe in einem längeren Prozess auf die Untersuchung von zwölf Flügen, darunter acht mit einem Airbus 319, dem am EAP am häufigsten anzutreffenden Flugzeugtyp, sowie vier Frachtflüge mit Frachtjumbos vom Typ Boeing 747, die vergleichsweise laut sind und zudem meist am späteren Abend starten. Die eigentliche Untersuchung fand dann zwischen 2014 bis 2016 statt, und zwar in Regie des Pariser Ingenieurbüros BIPE, das schon früher Untersuchungen zum Lärm für den EAP betreut hat. Auch das war aus Sicht der BISF aber eine suboptimale Wahl, da dieses Büro nach ihren Angaben keine Erfahrungen mit dem Thema gehabt habe und die Beauftragung zudem einseitig durch den EAP erfolgt sei.
Jenseits der formalen Ebenen entzündet sich die Kritik aber vor allem an der inhaltlichen Bewertung der Resultate. Denn trotz aller Schwächen und der vergleichsweise schmalen Datenbasis, die nach Ansicht der BISF in keinem Verhältnis steht zu dem hohen Aufwand, der für die Selektion aufgewendet wurde, nur Stichprobencharakter hat und einen Bruchteil der rund 70 000 infrage kommenden Flugverfahren abbildet, zeigen diese aus Sicht der Initiative auf, „wie notwendig es wäre“, diese Daten über einen längeren Zeitraum zu erfassen und periodischen darzustellen.
Das wohl wichtigste Ergebnis sei dabei das Ausmaß der „Schallimmissionen am Boden“, heißt es in der Mitteilung. Faktisch läge das Gros der realen Werte nämlich höher als die angenommenen Mittelwerte, und zwar um zirka 5,3 Dezibel.
Während die Dokumentationen des Flughafens Efringen-Kirchen beispielsweise regelmäßig als nicht betroffen einstuften und jenseits der 50 Dezibel-Zone verorteten – womit der wahrnehmbare Lärm laut Schallpegeltabelle unter der leiser Radiomusik liegt, als Zimmerlautstärke gelten 55 Dezibel – zeigten die Lärmschleppen, dass der Schall auch noch bis Zell hörbar sei. Auch ein Kurort wie Bad Bellingen wäre danach viel stärker betroffen.
„Dieser Zustand der trinationalen Belastung kann so nicht mehr hingenommen werden“, kommentiert die BISF – zumal vor dem Hintergrund des steigenden Flugaufkommens, das bei den aktuellen Wachstumsraten in rund 15 Jahren gegen 150 000 Flugbewegungen tendieren dürfte (2015: 94 359). Auch daher fordern die Bürgerinitiativen – dazu zählen neben der BISF die elsässische Association de Defensé Riverains de l’ Aeroport de Balé-Mulhouse (Adra) sowie das Forum und der Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen aus der Schweiz – eine Vertiefung der „Ministudie“.
Lärmschleppenanalyse
Der Begriff beschreibt ein computerunterstütztes Verfahren, den am Boden ankommenden Schall eines An- oder Abfluges mit einer zertifizierten Software zu berechnen. Die Analyse wird bereits an diversen Standorten angewendet, um Fluglärm zu kartografieren. Es ist dabei möglich, einzelne Flüge oder die Gesamtbelastung über längere Zeiträume wie ein Jahr darzustellen. So wurde etwa der Betrieb am Flughafen Frankfurt über Jahre analysiert. Auch die französische Luftfahrtbehörde ACNUSA empfiehlt Lärmschleppenanalysen.