Die traditionsreiche Waldshuter Junggesellenschaft ist seit Jahrhunderten nicht von der Chilbi (alemannisch für „Kirchweih“) wegzudenken. Neben den Schützen waren sie stets die Hauptakteure jenes Festes, das bis ins 19. Jahrhundert eine ganz „normale“ Kirchweih darstellte und noch nicht mit dem Gedenken an die Belagerung von 1468 verbunden war. Während man der Belagerungsopfer am Samstag vor dem 1. September gedachte, war der Termin für die Waldshuter Kirchweih traditionell der Sonntag nach dem 15. August (Patrozinium).
Ab dem frühen 18. Jahrhundert sind im Stadtarchiv Überlieferungen zu ihrem Ablauf erhalten. Kirchweihfeiern gehörten damals zu den weinseligsten und ausschweifendsten Veranstaltungen überhaupt. Die gesamte Bürgerschaft machte mittags einen feierlichen Auszug zum damaligen Schützenhaus auf der Oberwiese vor dem Oberen Tor, wo ein Wettschießen stattfand. Die „jungen Gesellen“ ließen am Abend in den Wirtshäusern der Stadt zum Tanz aufspielen, später wurde ein „Tanzboden“ auf der Wiese hergerichtet. Die Statuten der Gesellen von 1768 geben diese Festbeteiligung als alten Brauch an; ein unter ihnen gewählter Platzmeister besorgte die Musiker und kümmerte sich auch sonst um die Organisation. Wer sich nicht an Umzug und Tanz beteiligte, musste eine Geldstrafe an die Kasse abführen.
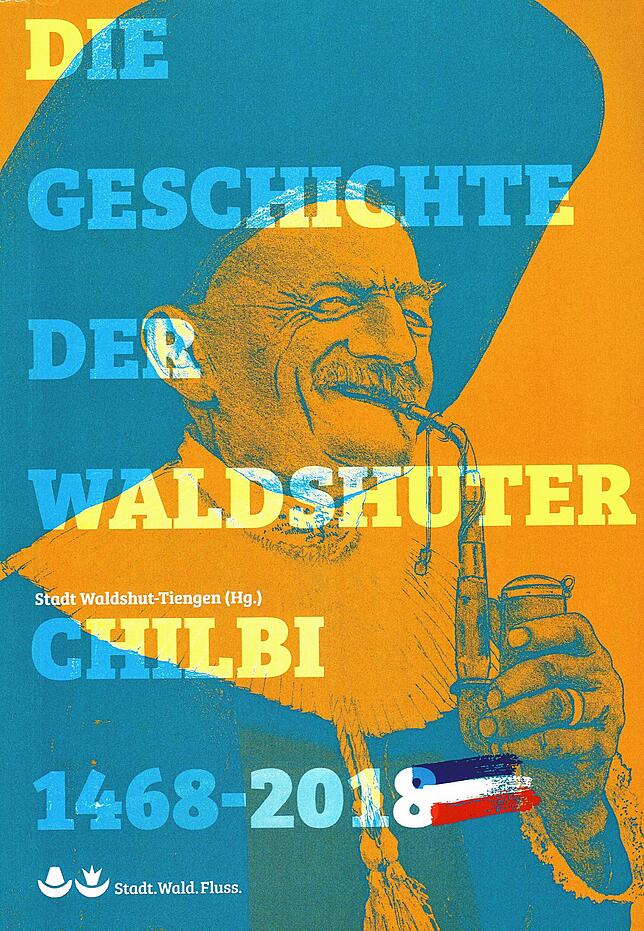
Auch das Brauchtum rund um den Kirchweihbock (wenn auch erst 1820 belegt) dürfte eine lange Tradition haben. Ein junger Schafbock, der von jungen „Kerbburschen“ dekoriert, mitgeführt und sodann (je nach lokaler Tradition) verlost, versteigert oder im Wettkampf gewonnen wird, ist im ganzen süddeutschen Raum seit dem Spätmittelalter häufig auftretendes Element von Kirchweihfeiern und insofern keine Waldshuter Besonderheit (und hat daher auch ursprünglich nichts mit der historischen Belagerung zu tun). Der stark in der Religion verwurzelte Brauch geht vermutlich auf abgelöste frühere Naturalabgaben an den Patronatsherrn der Kirche zurück, von Gedanken der Festtagsliturgie zur Konsekration des Kirchengebäudes geprägt. Mit der Zeit wurde er zur reinen Gaudi und hat sich in Waldshut, im Gegensatz zu anderen Orten, erhalten.
Ihre Chilbi war den Waldshutern immer wichtig. Dies zeigt auch die Geschichte ihres zäh errungenen Überlebens: Die Festivitäten am Augusttermin wurden in Waldshut auf bestenfalls halblegale Weise beibehalten, nachdem die habsburgische Regentin Maria Theresia im Jahr 1766 (im besorgten Kampf gegen solch „unnütze“ Gelage, zu denen Menschen von nah und fern hinströmten) sämtliche Kirchweihbegängnisse im Land einheitlich auf einen Termin im Oktober verlegen ließ – sie wurden von den Waldshutern vorübergehend einfach nicht mehr so genannt. In den 1850er Jahren, als aufgrund der Revolutionswirren das Abhalten von Schießveranstaltungen verboten war (das Wettschießen war damals Herzstück der Chilbi), rettete das Fest wiederum, dass es kurzerhand zur gut patriotischen Gedächtnisfeier für das ruhmreiche Standhalten bei der Belagerung von 1468 erklärt wurde, was die Behörden offensichtlich beruhigte. Die Feiern, die „Kirchweih“ nur noch im Namen führend, wurden wieder genehmigt.
1858 konnte die Chilbi also nach zehnjähriger Pause wieder gefeiert werden, nun an einem neuen Standort: das neue Schützenhaus nördlich der Bahngleise wurde feierlich eingeweiht. Auch die Junggesellen, die sich inzwischen als Verein neu formiert hatten, waren wieder dabei. Es wurde wie in alten Zeiten getanzt, gekegelt und gezecht. Man zog mit dem bekränzten Bock auf den Festplatz, am Abend konnte endlich wieder die Verlosung stattfinden, die damals bereits im Wesentlichen wie heutzutage ablief. „Die Waldshuter Chilbi ohne Chilbibock ist für den Waldshuter Bürgersmann und die von weit und breit herbeiströmende Landbevölkerung geradezu undenkbar“, so ein damaliges Schreiben. Der Bock freilich erfuhr nun eine Neudeutung.
Anfang der 1880er Jahre taucht in den Quellen erstmals die Behauptung einer angeblichen Waldshuter Kriegslist während der Belagerung auf, um auch diesen alten Kirchweihbrauch (dessen Herkunft längst vergessen war) in das neue Heldengedenken an 1468 zu integrieren. Der weltweit an vielen Orten bekannte Topos „gemästetes Tier rettet aus Belagerungsnot“ hatte nun also auch in Waldshut einen Vertreter.
Dass der Schafsbock zur Täuschung der Belagerer über den Stand der Vorräte über die Mauer ins eidgenössische Lager geworfen worden sein soll, glaubten jedoch schon damals nicht alle. Lokalhistoriker Birkenmeyer mutmaßte 1889, er sei einfach eine Anspielung auf die damalige schlimme Versorgungslage, als letztes verbliebenes „zur Nahrung geeignetes Gethier“. Jedenfalls war er unbestritten die große Attraktion und geradezu Symbolfigur für die Waldshuter Chilbi.
Ab 1901 wurde selbst die Bockbeschaffung durch die Junggesellen groß zelebriert, mit ihrer feucht-fröhlichen „Bockreise“, die sie von nun an über Jahrzehnte jährlich zum Berghaus bei Krenkingen führte. Ebenfalls seit 1901 findet die Chilbi im Schmitzinger Tal statt, da erneut das Schützenhaus seinen Standort wechselte. Bei der Chilbi traten seinerzeit rund 200 Schützen an. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es freilich die Junggesellen, die das Fest wiederbelebten. 1919 und 1920 richteten sie Chilbi-„Gedächtnisfeiern“ aus, im Waldschlossgarten gab es Tanz und Bockverlosung. Ab 1921 konnte dann wieder groß auf dem Chilbiplatz gefeiert werden. Immer mehr Schausteller kamen mit ihren Attraktionen, und durch die neue Vereinigung „Alt-Waldshut“ bekam der Umzug ab 1926 einen mehr historisierenden Charakter (mit Trachten und „Waldshuter Männle“).
Immer stärker rückte die Inszenierung der Geschichte von 1468 ins Zentrum, insbesondere 1928, als rund 150 Kostümierte im Festzug Belagerer und Belagerte darstellten. Auch verlagerte sich, unter dem Unmut der Junggesellen, das Festgeschehen zunehmend in die Innenstadt. Die Chilbi wurde verstärkt zum allgemeinstädtischen Volksfest, die Aktivitäten der Junggesellen (und Schützen) nur noch ein Programmpunkt unter vielen. Sich dem allgemeinen Trend anpassend, empfanden bald auch die Junggesellen ihre übliche Festtagskluft mit Frack und Zylinder als nicht mehr zeitgemäß und legten sich folkloristische Trachten zu, die 1937 erstmals getragen wurden.

Auf anderen Gebieten hingegen verweigerte man sich standhaft der Anpassung an Zeitgeistiges: Das von den neuen Machthabern erzwungene Ausscheiden des jüdischen Mitglieds Artur Siegbert empörte die Junggesellen derart, dass der entsprechende Protokollbucheintrag (mit innigen Sympathiebekundungen für den früheren Kassierer, der offen ein „Opfer der jetzigen Zeit“ genannt wird) seinen Weg bis in die Akten der NS-Behörden fand.
Nach dem Krieg waren es erneut die Junggesellen, deren Aktivitäten den Grundstein für die Wiederaufnahme der Chilbi legten, mit einem „Bockaufzug“ (unter französischer Aufsicht) bereits 1946. Neue Gebräuche wie die „Bocktaufe“ kamen seither zu den Aktivitäten hinzu, doch im Kern pflegen die jungen Männer immer noch ein jahrhundertealtes lokales „Kulturerbe“, das sich zu sehen lohnt.












