Für 90 Mieter in der Jacob-Burckhardt-Straße hat die Kraft der Sonne eine besondere Bedeutung: Wenn sie es klug anstellen und beispielsweise dann die Wäsche waschen, wenn der selbst erzeugte Sonnenstrom fließt, können sie kräftig sparen. Bis zu 120 Euro im Jahr ließen sich so gewinnen, sagt Kuno Werner, einer der beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz. Der lokale Energieversorger und die Wohnungsbaugesellschaft Konstanz (Wobak) kooperieren in der Jacob-Burckhardt-Straße und an drei weiteren Standorten in Konstanz, um das selbst entwickelte neuartige Mieter-Strommodell zu verbreiten. Dahinter verbirgt sich ein intelligentes Messsystem, welches es ermöglicht, den im Haus selbst erzeugten und von den Mietern genutzten Strom besonders günstig abzurechnen. Der baden-württembergische Umwelt-Minister Franz Untersteller (Grüne) informierte sich gestern vor Ort über die Pilotanlage, weil er sie als besonders innovativ betrachtet.
Stadtwerke und die Wobak haben inzwischen für 170 Mieter in zwölf Konstanzer Mehrfamilienhäusern das Mieterstrom-Modell installiert. In der Jacob-Burckhardt-Straße basiert es auf der Kombination von Sonnenstrom sowie Strom und Wärme aus einem Blockheizkraftwerk, dessen Kernstück ein mit Gas betriebener Motor ist. Die Wärme wird zum Erhitzen von Brauchwasser oder für die Fußbodenheizung verwendet, der Strom wird nach Bedarf von den Mietern abgerufen. Unter dem Strich erzeuge die Anlage mehr Strom als die sechs angeschlossenen Häuser benötigten, sagte Richard Dederichs vom Energieservice der Stadtwerke Konstanz. Doch nicht immer wird der selbst produzierte Solarstrom dann abgerufen, wenn er zur Verfügung steht.
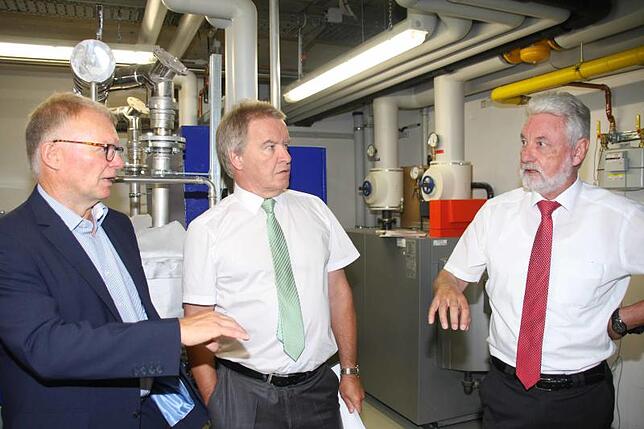
Das Mieterstrom-Modell will dazu anregen. Die Stadtwerke geben den selbst erzeugten Strom besonders günstig an die 80 Prozent der Mieter ab, die sich in den vier Wohnanlagen am Modellprojekt beteiligen. Dazu setzen sie eine selbst entwickelte, besondere Messtechnik ein, die alle Viertelstunde exakt erfasst, wie es mit der Stromproduktion im Haus steht und welcher Mieter welche Form von Strom nutzt.
Solche Digitaltechniken seien ein wesentliches Thema bei der Energiewende, sagte Untersteller. Bald werde es intelligente Elektrogeräte geben, die selbst erkennen, wann der günstige Strom fließt, und sich dann einschalten können. Auch die Kraft-Wärme-Koppelung wie in Blockheizkraftwerken werde bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen. Die Anlagen seien hocheffizient und hochflexibel. Sie ergänzten den Einsatz der regenerativen Energien. Bei der Kraft-Wärme-Koppelung sei der Ausstoß von Treibhausgasen wesentlich niedriger als bei der getrennten Erzeugung. Um die Kraft-Wärme-Koppelung im Land voranzubringen, sei schon in der vergangenen Legislaturperiode eine Ausbaustrategie entwickelt worden. Ehrgeiziges Ziel sei es, den bisherigen Anteil der Kraft-Wärme-Koppelung an der Stromerzeugung bis in drei Jahren von zwölf auf 20 Prozent anzuheben. Um dies zu erreichen, wurde unter anderem bei der Energieagentur Baden-Württemberg das Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Koppelung eingerichtet. Dort können sich beispielsweise Kommunen, Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und Privatleute informieren, welche Einsatzmöglichkeiten der Technik es für ihre Vorhaben gibt.
Zudem gebe das Förderprogramm Nahwärme Anreize für Kommunen, Wärme-Pläne zu erstellen, und etwa festzuschreiben, wo der Einsatz der Kraft-Wärme-Koppelung sinnvoll wäre. Nach Konstanz besuchte der Minister die Gemeinde Aldingen im Landkreis Tuttlingen, die mit einem Nahwärmenetz das Hallenbad im Ort, die Gemeindehalle, das Schulzentrum und die Sporthalle mit Wärme versorgt, die aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde.
Kuno Werner, einer der Geschäftsführer der Stadtwerke, bezeichnete das Konstanzer Mieter-Strommodell als wichtigen Beitrag zur regionalen Energieversorgung und zur Energiewende. Es eröffne den Stadtwerken auch künftige Geschäftsfelder, etwa mit dem Kommunikationsnetz aus Glasfaser. Der flächendeckende Ausbau sei im Gange. Sozialbürgermeister Andreas Osner begrüßte es, dass über die Stadtwerke und die Wobak die Versorgung in kommunaler Hand bleibe. Auch im neuen Schwaketenbad werde die Kraft-Wärme-Koppelung zum Einsatz kommen. Die Stadtwerke und die Wobak sind dabei, auch bei anderen Bauvorhaben wie am Zähringer Hof innovative Energietechniken einzusetzen. Auch hier ist die Kombination aus Kraft-Wärme und Fotovoltaik geplant. Das Mieterstrommodell und die Versorgungsarten wollen sie immer weiter entwickeln. Langfristig könnten etwa Speicher-Batterien zum Einsatz kommen. Zu den schon umgesetzten Pilotanlagen in Konstanz gehören neben den 90 Wohnungen in der Jacob-Burckhardt-Straße 27 Wohnungen und zwei Gewerberäume am Drechslerweg (Wollmatingen), 30 Wohnungen in der Hegaustraße (Petershausen) und 24 Wohnungen am Schmidtenbühl (Dettingen).
Auch hier fließt der lokale, dezentral erzeugte Strom.
Die Puffer-Energie
Baden-Württemberg hat ein großes Ziel: Bis im Jahr 2050 soll der Ausstoß an Treibhausgasen um 90 Prozent im Vergleich zu dem im Jahr 1990 sinken. Neben dem Einsatz der regenerativen Energien wie Sonnen- und Windkraft will das Land den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung als Puffer-Energie beschleunigen. Diese soll zur Verfügung stehen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Im Gegenzug soll die Stromerzeugung aus Kohle eine immer kleinere Rolle spielen. Kohle setzt beim Verbrennen besonders viel des schädlichen Treibhausgases Kohlendioxid frei. Bei der Kraft-Wärme-Koppelung erzeugen Anlagen aus Gas, das idealerweise aus Biomasse gewonnen wurde, Strom und Wärme. Der Anteil der Kraft-Wärme-Koppelung bei der Stromerzeugung soll in Baden-Württemberg bis 2020 von zwölf auf 20 Prozent steigen. Neben dem Strom kann aus solchen Anlagen auch die Wärme zum Aufheizen von Wasser oder von Heizungen in den Haushalten genutzt werden. (rin)






