Wasser aus der Kläranlage nutzen, um Gebäude zu heizen? Das klingt erst einmal merkwürdig – ist aber ein Vorhaben, das die Stadtwerke Radolfzell derzeit ernsthaft verfolgen. „Es ist das größte Projekt, das wir in der Planung haben“, erklärt Geschäftsführer Tobias Hagenmeyer. „Das legt den Grundstein für die kommunale Wärmewende.“
Auch Firmen sollen angeschlossen werden
Stefanie Hambalek, die für die Wärmeplanung bei den Stadtwerken Radolfzell zuständig ist, berichtet von den Hintergründen des Projekts: So solle das Nahwärmenetz beim Milchwerk verändert werden. Parallel seien Anfragen aus der dem Milchwerk nahen Industrie gekommen, ob die Stadtwerke nicht ein Angebot habe, durch das die Unternehmen ihre Wärmeversorgung nachhaltig gestalten können. Und außerdem sei die Bebauung des Gleisdreiecks bei der Günter-Neurohr-Brücke geplant – auch das Gebiet muss einmal mit Nahwärme versorgt werden. „Zeitlich kommt alles gut zusammen“, so Hambalek.
Aus diesem Grund umfasst die Planung der Stadtwerke für eine Nahwärmeversorgung über die Kläranlage eben nicht nur das Milchwerk, sondern auch die Firmen Allweiler, Schiesser, Hesta, Hügli, das Seemaxx und das Gleisdreieck. Genutzt werden soll dafür Abwärme aus dem geklärten Abwasser, das durch das Klärwerk am Schießhüttenweg fließt – ein Novum bei den Stadtwerken Radolfzell. „Das ist ein ganz neuer Ansatz“, betont Tobias Hagenmeyer.
Wie geht das?
Aber wie kann so etwas funktionieren? Wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg erklärt, hat die Nutzung von Wärme aus Abwasser ein hohes Potenzial. Sowohl in Haushalten, als auch in der Industrie werde täglich Wasser erwärmt – und dieses warme Wasser nach Gebrauch ins Abwasser geleitet. „Mittels moderner Wärmepumpentechnologie kann diese Wärme effizient und umweltfreundlich zum Heizen oder Kühlen größerer Gebäude und Wohnsiedlungen genutzt werden“, so das Ministerium. Und weiter: „Die Abwasserwärmenutzung ist eine langfristig sichere und erneuerbare Energiequelle und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Sie reduziert den Kohlendioxid-Ausstoß im Vergleich zu einer herkömmlichen Ölheizung um 60 Prozent und mehr.“
Stefanie Hambalek erklärt die Abläufe, die in Radolfzell geplant sind: Demnach würde auf dem Gelände der Kläranlage das Wasser zu drei Wärmetauschern geleitet. Dort werde dem Wasser Wärme entzogen. Diese Wärme käme in einer Großwärmepumpe mit einer Leistung von zwei Megawatt thermischer Leistung zum Einsatz. Zum Vergleich: Aus der Biogas-Anlage in Möggingen, die das dortige Nahwärmenetz versorgt, kommen 350 Kilowatt thermische Leistung. Um die Großwärmepumpe anzutreiben, kann Strom aus Photovoltaikanlagen genutzt werden.
Zu Zeiten, in denen besonders viele Menschen Bedarf für Wärme haben – etwa morgens, wenn viel Warmwasser benötigt wird – soll zudem ein großer Pufferspeicher zum Einsatz kommen. In diesem werde Wasser gespeichert, das von überschüssiger Energie aus der Wärmepumpe gewärmt wird. Wird auf einmal viel warmes Wasser gleichzeitig benötigt, werde jenes aus dem Pufferspeicher genutzt.
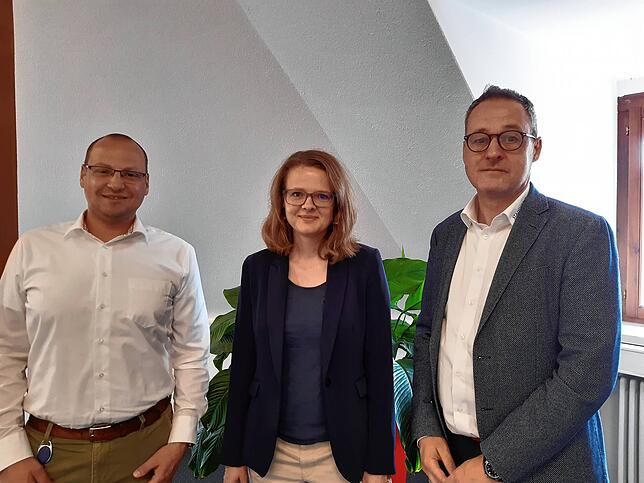
„Ganz ohne Gas kommen wir noch nicht aus“
Aktuell wird das Milchwerk noch mit Gas geheizt. Das soll auch nicht vollständig ersetzt werden. „Ganz ohne Gas kommen wir noch nicht aus“, erklärt Stefanie Hambalek. Wenn der Bedarf außerhalb der warmen Monate besonders hoch ist, brauche es noch ein Gas-Blockheizkraftwerk, das zugeschaltet wird. Und wenn es ganz kalt sei, könne zudem noch ein Gas-Spitzenlastkessel zugeschaltet werden.
Hambalek erklärt: Heizzentralen, an denen größere Wärmenetze hängen, werden ausschließlich modular aufgebaut, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sollte ein Aggregat mal ausfallen und die Reparatur länger benötigen, als es die 24-Stunden-Bereitschaft der Stadtwerke zu bewerkstelligen vermag. Das Blockheizkraftwerk soll künftig aber auch mit so genanntem grünem Gas betrieben werden können. Und insgesamt sollen in der ersten Ausbaustufe 77 Prozent des Energiebedarfs über die Wärmepumpe gedeckt werden.
Der überschüssige Strom aus dem Blockheizkraftwerk solle zudem genutzt werden, um im Winter, wenn weniger Strom aus Photovoltaikanlagen gewonnen wird, die Großwärmepumpe anzutreiben.
Wie geht es jetzt weiter?
Wie Stefanie Hambalek berichtet, haben die Stadtwerke bereits mit den Zuständigen der Kläranlage gesprochen. Auf dem Gelände gebe es genügend Platz für eine Heizanlage, wo genau diese aufgebaut werden könnte, müsse aber noch geklärt werden. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut“, freut sich Tobias Hagenmeyer.
Auch mit der Deutschen Bahn ist man laut Hambalek bereits in Kontakt, weil für den Bau des Nahwärmenetzes die Gleise gequert werden müssen. Und auch mit allen betroffenen Firmen habe man gesprochen. Bei dem geplanten Nahwärmenetz habe man eine kurze Netzlänge, aber eine hohe Dichte an versorgten Gebäuden. So könne mit relativ geringem Netzausbau viel CO2 gespart werden – möglich seien 2800 eingesparte Tonnen pro Jahr.
Aber, so betont Stefanie Hambalek: „Wir brauchen eine Förderung, damit das Projekt wirtschaftlich läuft.“ In diesem Jahr habe man einen Antrag auf Förderung nach der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) für eine aktuell laufende Machbarkeitsstudie inklusive Planung gestellt. Ende des Jahres solle ein weiterer Förderantrag gestellt werden, dabei gehe es dann um die Förderung der Investition. Aktuell sei geplant, ab 2025 an die Realisierung zu gehen.
Mehr Potenzial in der Zukunft
In Zukunft hätte das Projekt der Nahwärmegewinnung aus dem Klärwerk auch noch mehr Potenzial, wie die Verantwortlichen erklären: Perspektivisch könnte so auch die Konstanzer Straße an das Netz angeschlossen werden. Und es wäre eventuell auch möglich, zusätzlich Seewärme und die Abwärme aus der nahen Industrie zu nutzen.








