Alternative Energieformen sind mehr und mehr im Kommen. Spätestens seit der Energiekrise denken immer mehr Menschen und Städte über eine Alternative zu Gas nach. Vor allem Gemeinden und Energieversorger entscheiden sich für eine Wärmepumpe, wie sie etwa im Aachbad in Singen zum Einsatz kommt. In Neuhausen am Rheinfall hat sich das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG etwas Besonderes einfallen lassen: Sie nutzt die Kläranlage zur Energiegewinnung.
Fernwärmenetze nutzen in der Schweiz schon die Erde, Luft oder Wasser als erneuerbare Energiequellen. In Neuhausen am Rheinfall wurde das Fernwärmenetz des Energieverbund Neuhausen AG (EVNH) an die Kläranlage Röti angeschlossen, wo jährlich über neun Millionen Kubikmeter Abwasser von rund 60.000 Einwohnern gereinigt werden. Der Kläranlage Röti sind aktuell die Stadt Schaffhausen und acht weitere schweizerische Gemeinden angeschlossen. Im nächsten Jahr kommen die Schaffhauser Gemeinde Dörflingen und die deutsche Exklave Büsingen hinzu, deren Abwasser bisher in der Kläranlage Büsingen gereinigt wurde.
Das Fernwärmenetz macht sich zunutze, dass das Abwasser bereits warm ist: Das geklärte Wasser ist zwischen zehn und 25 Grad Celsius warm, maximal 760 Kubikmeter davon werden pro Stunde entnommen. Bei trockener Witterung entspricht das etwa 70 Prozent der Gesamtabflussmenge.
Die Abwärme wird in der Kläranlage Röti auf einen Sekundärkreislauf übertragen, der zwischen der Kläranlage und der Wärmestation im Kesselhaus auf dem SIG-Areal zirkuliert. „In Neuhausen wurde die Kläranlage unterhalb des SIG-Areals direkt an den Rhein platziert, das ist uns zugutegekommen“, erklärt Daniel Meyer. Er ist Leiter der dezentralen Energieversorgung des Elektrizitätswerks des Kantons Schaffhausen und Geschäftsführer des Tochterunternehmens EVNH. Zudem konnte die Energiezentrale des Wärmeverbunds direkt im alten Kesselhaus des SIG Areals untergebracht werden. Dadurch entfiel der Bau eines extra Gebäudes, Anlagen wie der alte Gaskessel und der Kamin konnten weitergenutzt werden.
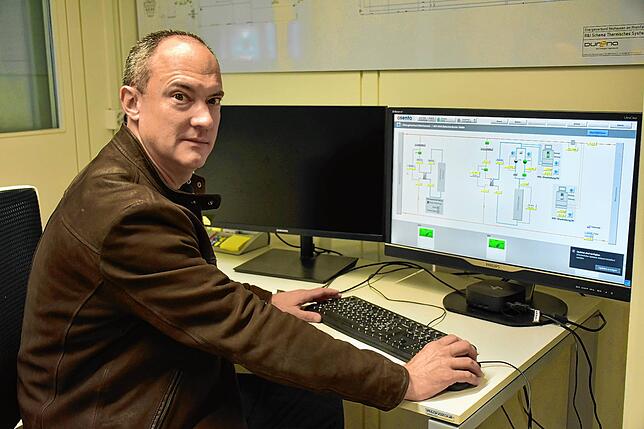
Durch die Wasserentnahme aus dem Auslaufbecken der Kläranlage gibt es auch keine Probleme mit der Quaggamuschel, die in Schweizer Gewässern insbesondere bei Wasserentnahmen für Schäden an den Anlagen sorgen.
Eine Fischart fühlt sich besonders wohl
Daniel Meyer erklärt, dass der Abschnitt des Rheins bei Neuhausen zu den letzten verbliebenen Äschenregionen der Schweiz zählt. Diese Fischart ist, wie andere Kaltwasserfische, insbesondere im erwachsenen Stadium sehr sensibel gegenüber hohen Wassertemperaturen und einem damit verbunden niedrigeren Sauerstoffgehalt im Wasser. Vor allem im Bereich von mittleren und größeren Kläranlagen ist die durchschnittliche Wassertemperatur oftmals zu hoch für die angesiedelten Fische, was für sie tödlich sein kann. Durch den Einsatz von Wärmetauschern fließt jedoch kälteres Wasser in den Rhein.
Der Schaffhauser Jagd- und Fischereiaufseher Patrick Wasem bestätigt auf Anfrage des SÜDKURIER, dass es im Bereich der Kläranlage Röti noch Äschen gibt, wenn auch nicht mehr sehr viele. „Durch die große Verdünnung des Wassers ist der Kühleffekt allerdings sehr klein, wenn sich der Rhein auf Temperaturen erwärmt, die für Äschen kritisch sind“, sagt Wasem.
Doch wie genau funktioniert das komplizierte Verfahren? Das warme Abwasser wird im Wärmetauscher bis fünf Grad Celsius abgekühlt und in den Rhein geleitet. Dazu sind drei hocheffiziente Wärmepumpen mit jeweils zwei Elektromotoren und Kompressoren mit einer Gesamtleistung von 4,5 Megawatt im Kesselhaus aktiv. Ammoniak dient als natürliches Kältemittel. „Dazu muss es im Wärmetauscher verdampfen können“, erklärt Daniel Meyer. Die elektrisch betriebenen Wärmepumpen komprimieren das Ammoniak mit hohem Druck, um hohe Temperaturen zu erzeugen.
Wärme wird über ein 8800 Meter langes Rohrleitungsnetz geleitet
In einem weiteren Wärmetauscher wird das Ammoniak wieder verflüssigt und erhitzt so einen dritten Wasserkreislauf auf rund 70 Grad Celsius. Die Wärme wird dann unterirdisch über ein 8800 Meter langes Rohrleitungsnetz an mittlerweile 220 Industrie-, Wohn- und Gemeindebauten geleitet und an einer Übergabestation mit einem weiteren Wärmetauscher in die privaten oder gewerblichen Heizungssysteme abgegeben. Bei dem Prozess werde die drei- bis vierfache Menge der elektrischen Energie als thermische Energie erzeugt, erklärt Meyer stolz. Zwei Gaskessel mit einer Wärmeleistung von jeweils 6000 Kilowatt sollen die Spitzenlast an kalten Tagen und die Redundanzen bei eventuellen Ausfällen abdecken, wobei laut Meyer rund 15 Prozent der Jahresproduktion bereitgestellt werden.

Da beim Betrieb von Wärmepumpen als Nebenprodukt Kälte anfalle, könne diese in einem Teilgebiet an Kunden mit Kältebedarf geliefert werden. Die Energieproduktion des Verbunds liegt bei rund 20 Millionen Kilowattstunden (kWh) und soll im Endausbau jährlich 40 Millionen kWh Wärme liefern. Mit dem Energieverbund werden in den nächsten 30 Jahren rund 138.000 Tonnen CO₂ eingespart. Bei zunehmendem Absatz durch die Netzverdichtung sei die Realisierung einer Holzheizzentrale vorgesehen, so Meyer. So soll ein Teil der Spitzenlast im Winter klimafreundlich abgedeckt werden.







