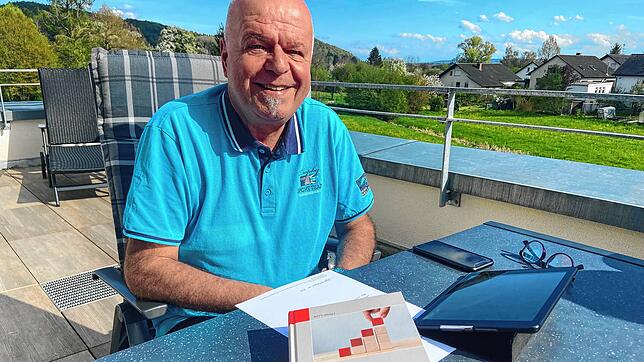Mit Blick auf die Bürgermeisterwahl in Engen kann man getrost sagen: Das ist ein starkes Teilnehmerfeld. Mit Tim Strobel, Marco Russo und Frank Harsch gibt es schon jetzt eine bunte Mischung aus Jung und Erfahren – allesamt mit Verwaltungserfahrung. Dies war nicht immer und bei jeder Wahl so. In Tengen beispielsweise hatte sich lange gar niemand für den ersten Wahlgang gemeldet.
Warum ist das so? Einer der es wissen muss, ist Paul Witt aus Steißlingen. Er gilt weit über den Hegau hinaus als Bürgermeistermacher. Denn Witt war viele Jahre Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und hat viele Bürgermeisterkarrieren mit seinen Kursen beeinflusst. Er spricht mit dem SÜDKURIER über die Neuerungen bei den Wahlen, warum die Bewerbersuche immer schwieriger wird und weshalb Lokalmatadoren statistisch die schlechteren Chancen haben.
Die Stichwahl ist nicht die beste Lösung
Viele Wahlen hat Paul Witt schon erlebt und begleitet, doch künftige machen ihm etwas Kopfzerbrechen. Grund ist das neue Wahlrecht, das neue Bewerber im zweiten Wahlgang nicht mehr ermöglicht. „Im Landkreis Konstanz gab es in der letzten Zeit vermehrt Fälle, wo eigentlich nur schwer wählbare Bewerber im ersten Wahlgang da waren“, sagt er. Dort hätte die seit wenigen Monaten geltende Verfahrensweise schnell für Chaos in de Gemeinden sorgen können, so Witt weiter.
Erstmal abwarten und sich später bewerben, geht also nicht mehr. Bürger müssten vielleicht schon im ersten Wahlgang aktiv werden und ihren Favoriten zu einer Bewerbung motivieren.
Lokalmatador oder nicht?
Thomas Auer in Gailingen und Michael Klinger in Gottmadingen sind laut Witt Ausnahmen. Warum? Laut dem Experten gebe es Untersuchungen, die besagen, dass nur zehn Prozent der einheimischen Bewerbung gelingen würden. „Je herausgehobener die Position des Einheimischen ist, desto schwieriger wird es“, sagt Witt. Was er damit meint: Einheimische, die bereits ein Amt ausüben, etwa ein Fraktionsvorsitzender oder der Leiter der Musikschule, stünden nicht immer oben in der Wählergunst. Der Grund: „Der Wähler will einen neuen, frischen von außen kommenden Wind.“ Verflechtungen innerhalb der Gemeinde seien oftmals nicht gewollt.
Ein Beispiel dieser These ist die Bürgermeisterwahl in Tengen: Dort hat Selcuk Gök als externer Kandidat im zweiten Wahlgang gegen mehrere lokale Gegenkandidaten gewonnen. Auch die Radolfzeller setzten bei der Oberbürgermeister-Wahl mit Simon Gröger auf einen externen Kandidaten. Und der neue Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, Christoph Stolz, stammt zwar aus Stockach, sammelte aber einige Jahre in Schwaben Erfahrungen.
Nur neun Prozent der Bürgermeister sind Frauen
Aber wieso gibt es so wenige Frauen als Rathauschefin? Bevor Witt auf diese Frage antwortet, macht er deutlich: „Frauen haben genau die gleichen Chancen, gewählt zu werden, wie Männer.“ Wenn sie gegen Amtsinhaber antreten, hätten sie Studien der Hochschule in Kehl zufolge sogar bessere Chancen auf den Wahlsieg. Dass sie weniger gewählt würden, liege vielmehr daran, dass Frauen seltener kandidieren.
„Obwohl in unserer Hochschule derzeit über 75 Prozent Frauen studieren, liegt der Frauenanteil bei Bürgermeistern mit neun Prozent auf sehr niedrigem Niveau„, sagt Witt. Ein Grund sei ein familienpolitischer Gedanke. „Viele junge Frauen können sich eine Vereinbarkeit von Familie und Bürgermeister-Beruf nicht wirklich vorstellen“, so Witt weiter.
Noch ein Grund: „Frauen überlegen gründlicher als Männer, ob sie Bürgermeister werden wollen.“ Das führe dazu, dass sich Frauen oft nicht zutrauen, die Führungsaufgabe wahrzunehmen. „Wir Männer stolpern dort leichter rein“, sagt er.
Positive Beispiele müssen her
Laut Paul Witt könnten positive Beispiele dafür sorgen, dass mehr Frauen kandidieren. Ähnlich wie das Mentoren-Programm bei größeren Parteien. Und ein Umstand spreche für ihn deutlich für eine Frau als Bürgermeisterin: „Frauen sind viel leistungsfähiger als wir Männer, das muss man so zugeben.“
Dass es an Kandidaten für eine Bürgermeisterwahl fehlt, könne laut Witt so nicht festgestellt werden. In den vergangenen fünf Jahren hätten sich pro Wahl etwa 2,5 Bewerber gemeldet. „Da hat sich nicht viel geändert, die Zahl ist nicht sonderlich rückläufig“, sagt Witt. Dafür nennt er erstaunliche Zahlen: In Schwanau im Ortenaukreis hätten sich elf Kandidaten aufstellen lassen, in Rickenbach 2013 sogar ganze 28 und in Empfingen 13 Kandidaten. Auch in Tengen gab es acht Bewerber-Namen auf dem zweiten Stimmzettel.
Der Bürgermeistermacher merkt allerdings, dass die Qualität der Bewerber nachgelassen habe: „Die wählbaren Kandidaten werden weniger, das spüren wir schon.“ Er rate deswegen allen Gemeinden, Stellenausschreibungen nur in den lokalen Printmedien und im Staatsanzeiger auszuschreiben. „Peppige Ausschreibungen führen zwar zu mehr Bewerbern, aber nicht unbedingt zu mehr Qualität“, sagt Witt. Er appelliere deshalb daran, nicht diese Leute zu wecken, die eigentlich unqualifiziert seien.
Was ein Bürgermeister mitbringen muss
Ein Bürgermeister sollte laut Witt zum einen fachlich qualifiziert sein, zum anderen aber auch soziale Kompetenzen mitbringen. Er sollte ein offener Typ sein, authentisch und sollte mit Menschen umgehen und auf sie zugehen können. „Manche behaupten sogar, ein Bürgermeister sollte Menschen „lieben“! Er sollte ein kommunikativer Typ sein und Visionen haben“, sagt der Experte.
Bürger sind kritischer geworden, gerade online
Warum werden es immer weniger Verwalter? Alle Untersuchungen würden laut Witt darlegen, dass der Job des Bürgermeisters schwieriger geworden sei. Als Stichworte nennt er dafür Hass und Hetze im Internet. „Die Bürger sind kritischer geworden, dazu tragen auch die sozialen Medien bei“, sagt Witt. Unzufriedene Leute habe es schon immer gegeben, aber die Art und Weise der Kritik habe zuletzt stark gelitten.
Witt rate seinen Absolventen, dass Bürgermeister zwar soziale Medien nutzen, um ihre Botschaften auch anderen Wählerschichten schicken zu können. „Junge Leute erreicht man nicht mehr über das Amtsblatt“, sagt er. Um mit dem harscher werdenden Ton zurechtzukommen, brauche es ein dickes Fell. Und eine gewisse Gelassenheit gegenüber Meinungen Einzelner: „Wichtig ist, dass die große Mehrheit hinter der Arbeit eines Bürgermeisters steht.“