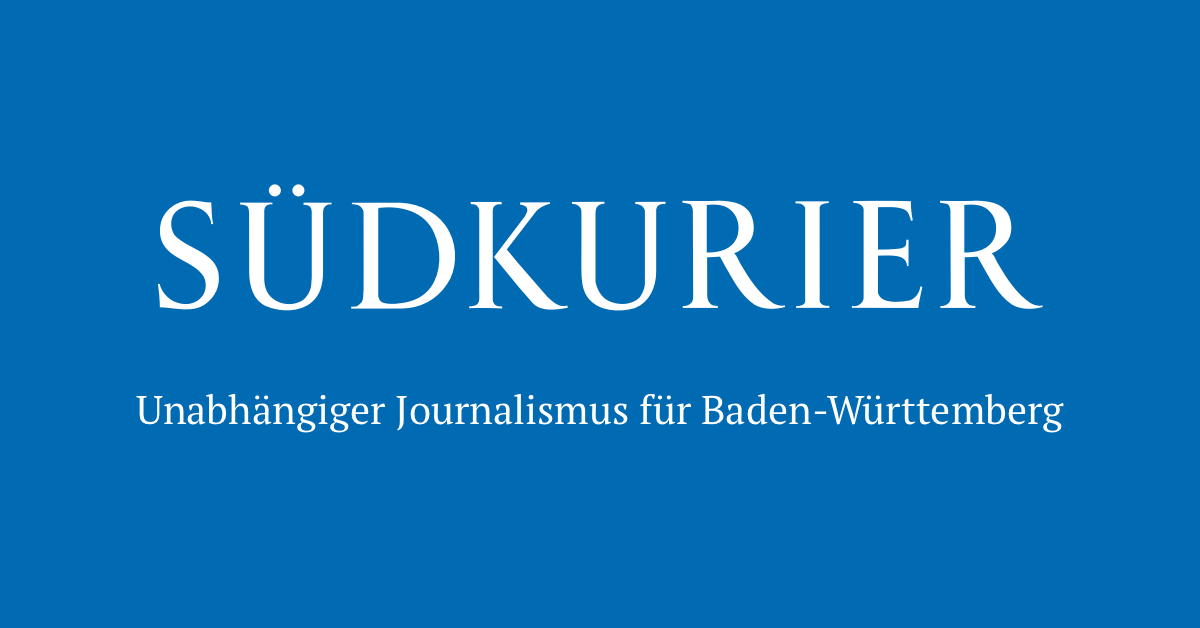Die Einwohner von Bad Saulgau und ihre Bürgermeisterin Doris Schröter dürfen stolz darauf sein: Mit der Wahl ihrer Stadt beim ökologischen Wettbewerb zur Landeshauptstadt der Biodiversität hat sie nicht nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweite Anerkennung für ihre Aktivitäten erfahren. Für den Begriff der Biodiversität steht die Artenvielfalt heimischer Tiere und Pflanzen in Verbindung mit deren Lebensräumen. So ist sie bekannt geworden für ihre Naturlehrpfade und ihren Einsatz für den Naturschutz.
Regelmäßig gehen Einladungen an den städtischen Umweltbeauftragten ein, um über die Aktivitäten und Projekte der Stadt zu berichten, wie Thomas Lehenherr, der städtische Umweltbeauftragte, bei einer Sitzung im Kreistag die Gremiumsmitglieder über den Sachstand informierte.

Ende 1990er Jahre hatte die Stadt begonnen, ihr Konzept „Umwandlung von Einheitsgrün in artenreiches Grün“ in der Kernstadt und allen Ortsteilen umzusetzen. Es wurden, wo immer möglich, sämtliche intensiv bewirtschafteten Parkrasenflächen und -streifen in mehrjährige heimische Blumenwiesen und Pflanzbeete in artenreiche, naturnahe Staudenbeete umgewandelt.
Die Umwandlung in ein artenreiches Grün sei sozusagen die gelebte Biodiversität im Innenbereich der Stadt, stellt Lehenherr fest und verbindet dies mit dem Wunsch, „dass dieses Konzept im Kreis und den Kommunen noch viele Nachahmer finden wird“. Landrätin Stefanie Bürkle sagte, sie spüre sehr wohl, wie die Protagonisten dieses Thema auch leben.
Im ersten Schritt hatten sie bei den Intensivrasenflächen die Grasnarbe abgezogen, mit Wandkies aufgefüllt und mit unterschiedlichen dauerhaften heimischen Blumenwiesenmischungen (30 bis 40 Arten) eingesät. Diese Blumenwiesen werden zwei Mal pro Jahr gemäht und das Mähgut wird abtransportiert. Bei manchen Wiesen reichte es, nur die Düngung einzustellen und den Mährhythmus auf zwei Mal pro Jahr zu beschränken. Die Artenvielfalt stellte sich wieder von alleine ein.
Komplett aufgegeben wurden die Stauden-Wechselbepflanzungen, dafür wurden dauerhafte, heimische oder nichtheimische aber insektenfreundliche mehrjährige Stauden gepflanzt. In der Stadt sind an der Realschule, am Seniorenheim und am Störck-Gymnasium drei gut beschilderte Insekten- und Schmetterlingsgärten eingerichtet worden.

Die meisten Verkehrsinseln wurden entsiegelt und ebenfalls mit einer insektenfreundlichen Staudenbepflanzung versehen. Entsiegelt hat die Stadt auch viele Erschließungsstraßen am Straßenrand und dort Pflanzbeete geschaffen. So konnte dieses Konzept vor einem Jahr abgeschlossen werden. Wo es möglich war, seien alle Pflanzbeete und Wiesen in der Stadt und in den 13 Stadtteilen in ökologisch hochwertigere Flächen umgewandelt worden, berichtet Lehenherr.
Heute bereichern viele Hektar Blumenwiesen und naturnahe Staudenbeete die Stadt. Während der gesamten Vegetationszeit blüht es überall. Die Artenvielfalt nahm im Innenbereich sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Insekten enorm zu. Zu den Besonderheiten gehören die Weißstörche: 14 Paare haben sich inzwischen angesiedelt.
Im Vergleich zu früher hätten sich die Grünflächen verdoppelt, die Kosten für Pflanzmaterial aber halbiert. Nicht erhöht habe sich der Personalstamm der Stadtgärtnerei. Die herkömmliche Mineraldüngung und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sei eingestellt, der Mäh-Häufigkeit von bis zu 20 Mal pro Jahr auf zwei Mal pro Jahr reduziert, so Lehenherr, mit der Folge einer eier enormen Kosteneinsparung Für dieses Konzept erhielt die Stadt bundesweit schon viele Auszeichnungen. Ihre Besonderheiten:

- Naturlehrpfade: Es gibt einen 3,5 Kilometer langen Themen- und Erlebnisweg Wasser. Zwei Lehrpfade beinhalten auf je 500 Meter einheimische Gehölze. Zudem gibt es einen Obstbau- und Thermalwasserlehrpfad jeweils auf einen Kilometer Länge. Der Nistkastenlehrpfad erstreckt sich ebenfalls auf 3,5 Kilometer. Der Georundweg ist 43 Kilometer lang.
- Natur-, Rad- und Wanderwege: Rundwege im Landschafts- und Naturschutzgebiet Booser-Musbacher Ried, Rundwanderwege um die Ortsteile, Wasserscheidewanderweg sowie geschützte Hohlgassen. Die Wege sind gut und umfassend beschildert, in Wanderkarten eingetragen und in Broschüren beschrieben. Die Stadt richtet in Zusammenarbeit mit der Tourismusbetriebsgesellschaft mithilfe der „Leader“-Förderkulisse Mittleres Oberschwaben den Naturthemenpark ein (siehe danebenstehenden Bericht).
- Gewässerrenaturierungen: Schwarzach, Friedberger Bach sowie der Krähbach bei Fulgenstadt, insgesamt auf 15 Kilometer Länge.
- Naturschutzarbeit in Biotopanlagen: Krähbachtal in Fulgenstadt, in Großtissen und in Bolstern. Dazu zählt auch das Naturdenkmal Mösle in Kleintissen. in Gewässern: Wagenhauser Weiher (Badesee) und Zeller Weiher.
- 25 Naturdenkmale: Baum-Alleen am Sießener Fußweg, am Birkenweg. Feldgehölze bei Fulgenstadt und Friedberg sowie Einzelbäume wie due Blutbuche in Hochberg oder die Linde in Fulgenstadt.

Bad Saulgau in Zahlen
Die im Zentrum Oberschwabens liegende Kur- und Bäderstadt ist mit 18 000 Einwohnern die zugleich größte Stadt im Landkreis Sigmaringen. Sie breitet sich auf einer Fläche von rund 10 000 Hektar aus. Ihre 13 Ortsteile sind in einer topografisch, landschaftlich und geologisch abwechslungsreichen Landschaft eingebettet. Das erste Thermalbad in Oberschwaben bescherte Bad Saulgau im Jahre 2000 das Prädikat „Bad“. (jüw)
Entwicklung zur Naturbildungsstätte
Der Naturthemenpark sieht die Weiterentwicklung zu einer praxisorientierter Natur- und Umweltbildungsstätte vor. Zur Umsetzung wurden bereits drei Leader-unterstützte Projekte genehmigt oder teilweise umgesetzt.
Dieser Park gliedert sich in vier Schwerpunktbereiche: Pflanzen, Tiere, Wasser sowie Geologie und Landschaft. Durch dieses breite Angebot ist der gesamte Naturbereich abgedeckt. Ein passendes Thema dazu ist die Heilkraft des Waldes. Der strukturreiche Stadtwald bietet die ideale Kulisse dafür. In Zusammenarbeit mit den benachbarten Kurkliniken sollen Veranstaltungen angeboten werden.
Bereits 2017 wurde mit dem Themen- und Erlebnisweg Wasser ein gut beschilderter, 3,5 Kilometer langer neuer Lehrpfad für Familien und alle Interessierten mit Stegen und Plattformen zum Thema Wasser in der Nähe des zukünftigen Infopunktes geschaffen. Im Zentrum der Naturattraktionen ist eine vorhandene Forsthütte zum Infopunkt, das heißt, zum barrierefreien Ausgangspunkt für den Park ausgebaut worden. Vom „Leader“-Steuerungskreis genehmigt wurden zehn interaktive Naturerlebnisstationen für Kinder und Familien in der Nähe des Infopunktes.
Nach der Fertigstellung soll eine Organisation mit Naturpädagogen und Fachpersonal gegründet werden. Diese bietet neben dem städtischen Fachpersonal Führungen für Familien und Fachkundige sowie Kinderveranstaltungen an und betreibt den Infopunkt.
Projektziel ist die Stärkung der touristischen Infrastruktur, verbunden mit einer Erweiterung des naturnahen Erholungsangebots für die örtliche Bevölkerung, für Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden, für Ferien-, Klinik- und Kurgäste. Die vorhandenen Wege sollen mit neuen Verbindungswegen und Erlebnisattraktionen sowie Umweltbildungsangeboten und -einrichtungen in einem Naturthemenpark zusammengefasst und durch neue Angebote ergänzt werden.
Mit den neuen Projektbausteinen sollen junge Familien, Kinder und Jugendliche (Stichwort: Bildung zur nachhaltigen Entwicklung) aber die Gäste angesprochen werden. Ein Angebot mit interkommunaler Anbindung fördert den Tourismus. Alle Projektbausteine des Naturthemenparks bedeuten zudem für die Bürger einen Gewinn für die Naherholung. Eine weitere wichtige Zielgruppe sind Kommunen, Landkreise, Behörden, Naturschutzorganisationen, die die Inhalte des NTP zur nachhaltigen Nachahmung nach außen tragen sollen.
Dies Gesamtprojekt könnte auch für das Land als Beispiel einer praxisorientierten Umweltbildungsstätte für Behörden, Kommunen, Landkreise und die Bevölkerung dienen. Die Grundlagen dafür würden im Moment geschaffen. Eine mögliche Erweiterung könnte in Kooperation mit dem Land erfolgen. (jüw)