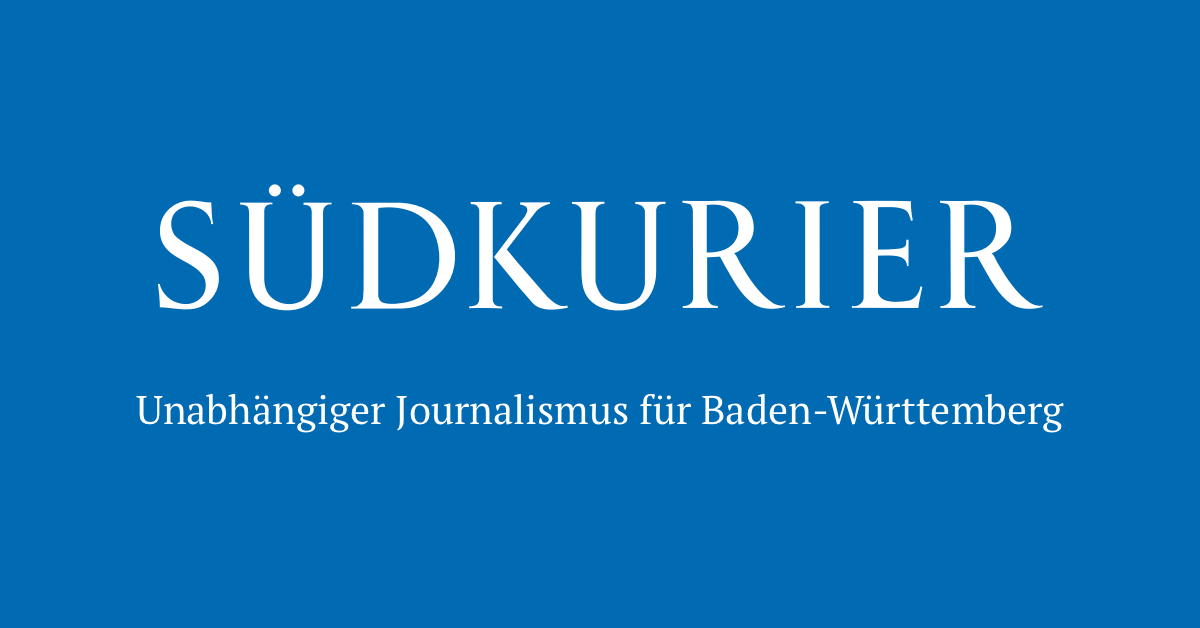Bei der Abschlussveranstaltung des Projekts „Landschaft als CO₂-Speicher“ haben sich 33 Personen im Landhotel Brigel-Hof in Langenhart getroffen, um über die Ergebnisse des zweijährigen praktischen Versuch zu berichten.

Mit Blick auf den Klimawandel waren die Fragestellungen hierbei, welche landwirtschaftliche Maßnahmen sich besonders effektiv erwiesen haben, aber auch, auf welchen Flächen diese Maßnahmen sinnvoll und praktikabel sind. Zudem sollte der Praxistest aufzeigen, wie groß das Potenzial zur CO₂-Speicherung innerhalb der beiden teilnehmenden Naturparke (NP) Obere Donau und Südschwarzwald realistisch ist.
Abschlussveranstaltung auf dem Brigel-Hof
Bei der Abschlussveranstaltung waren unter anderem mit dabei die Geschäftsführer beider NP, Bernd Schneck (NP Obere Donau), Roland Schöttle (NP Südschwarzwald), Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick, die beteiligten Landwirte, darunter Lothar Braun-Keller vom Bäumlehof in Leibertingen, auf dessen Betrieb der praktische Teil erfolgte. Und natürlich die Projektteam vom Dienstleister „unique land use“ GmbH aus Freiburg unter der Leitung von Thomas Asbeck, die dieses Projekt unterstützten und in der Veranstaltung die Ergebnisse vorstellten.
Praktische Vorführung auf dem Bäumlehof
Da durch den Klimawandel der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Naturschutz erhebliche Veränderungen bevorstehen, würden die Produktionsbedingungen schwieriger werden, so die Referenten.
Deshalb seien Einsparungen und/oder Speicherungen des Treibhausgases CO₂ „ein Gebot der Stunde“. Eine nachhaltige Landwirtschaft könne zur Kohlenstoffbindung unter anderem durch Humusaufbau, Optimierung bei Grün- und Ackerlandbewirtschaftung beitragen, ebenso wie durch Biomasseaufwuchs in Agroforstkulturen, bei der der Acker gemeinsam mit Ackerfrucht und Gehölzen bewirtschaftet wird.
Sechs Modellbetriebe im Naturpark Obere Donau
Die Modellbetriebe im NP Obere Donau – Vögtle aus Langenhart, Denz aus Königsheim, Braun-Keller, Leibertingen, der Wolfshof aus Beuron, der Betrieb Endriß aus Gammertingen-Bronnen und Hopp-Agrar aus Meßkirch – haben sich in in den beiden Projektjahren durch einen ganzen Maßnahmenkatalog hindurch gearbeitet:

So beispielsweise der Zwischenfruchtanbau, der den Boden vor Humusabbau schützen und gleichzeitig organisches Material zuführen soll, optimierte Fruchtfolgen, die eine positive Humusbilanz und eine stärkere Durchwurzelung erreichen sollen, Erntereste wie Stoppeln, Stroh, Wurzeln und anderes optimal verwerten, Bodenchemie und Nährstoffverhältnisse des Bodens herstellen, die ober- und unterirdische Biomasseproduktion durch Arten- und Sortenwahl beeinflussen und vieles andere mehr, das die Modellbetriebe testen und auswerten sollten.
Bodenbearbeitung mit dem Grasnarbenbelüfer
Als besonders wirksam scheint sich die Bodenbearbeitung mit dem Grasnarbenbelüfter, einem überdimensionalen Vertikutierer, herausgestellt zu haben. Maschinenverleiher Jürgen Bauer stellte das Gerät vor und Lothar Braun-Keller testete es anschaulich auf seinem Grünland.
Das Eindringen der starken Stahlspitzen hinterlässt Löcher im Boden, die zu einer tieferen Belüftung und damit zu einer besseren Durchwurzelung führen sollen. „Das ist eindeutig nachgewiesen“, so Bauer. Bei der großen Kompostanlage des Bäumle-Hofs konnten sich die Teilnehmer über die reduktive Kompostierung informieren und die „schnittfeste Gülle“ begutachten. Wie Friedrich Wenz von „humusfarming“ erläuterte, wird hierbei Gülle mit Holzhackschnitzeln, Stroh, Miscantus oder ähnlich ligninhaltige C-Quellen vermischt, wobei die Feuchtigkeit eingebunden wird.
185.000 Tonnen CO₂ können gebunden werden
In einer Tafelmiete (oben abgeflacht) aufgesetzt, kann der Kompost ohne umzusetzen, nach drei bis 12 Monaten direkt ausgebracht werden. „So können große Mengen Gülle quasi schnittfest gemacht werden“, sagte Wenz. Aufgrund all dieser Maßnahmen sei, so die Fachleute, für jeden Modellbetrieb eine praxisorientierte CO₂-Senkleistung errechnet worden. Dabei habe sich insbesondere für die flachgründigen Böden der Region gezeigt, dass die Grasnarbenbelüftung und die organische Düngung durch reduktive Kompostierung besonders wirkungsvoll sei. „In einem realistischen Szenario könnten so jährlich rund 185.000 Tonnen CO₂ in beiden Naturparken gebunden werden“, sagte Wenz. Dies entspreche den Emissionen von rund 25.500 Bewohnern.