Wenn Ramona Laufer beim Smalltalk erzählt, was sie beruflich macht, gibt es immer jemanden, der dann sagt: „Also, ich könnte das ja nicht. Aber klar, irgendjemand muss es ja machen.“ Die 25-Jährige ist Bestatterin, oder wie es korrekt heißt: Bestattungsfachkraft. Anfang Juli 2024 hat sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Der Berufswunsch stand schon als Kind fest
In ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Bestattungsunternehmen Preidel, Hirt und Butz aus Villingen, arbeitet die 25-Jährige nun als ausgelernte Fachkraft in ihrem Traumberuf.
Den wollte sie schon als Kind erlernen, nachdem sie einen Todesfall in der Familie miterlebte, blickt sie zurück. Weil sie zunächst keinen entsprechenden Ausbildungsplatz fand, hat Ramona Laufer nach der Fachhochschulreife zunächst Erzieherin gelernt und anschließend ein Jahr in diesem Beruf gearbeitet, bevor sie ihren Wunschberuf angehen konnte.
Ein Berufsbild im Wandel
Traumjob Bestatterin? Richtig gelesen. Wer bei Bestattern an bleiche, ältere Herren mit dunklem Frack und ernsten Mienen denkt, liegt falsch. „Der Beruf hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark gewandelt“, sagt Norbert Hirt, Schreinermeister, Bestattungsfachkraft und Chef von Ramona Laufer.
Hellblaues Poloshirt, leuchtend blaue Brille, neben ihm eine lebensfrohe junge Frau mit langen Haaren und Sommersprossen – düstere Frackträger sucht man in dem Bestattungshaus vergeblich.

Eine der größten Veränderungen in der Branche: Seit 2004 ist Bestattungsfachkraft in Deutschland ein anerkannter Ausbildungsberuf. Drei Jahre dauert die Ausbildung, die längst nicht alle schaffen. Manchen Stoff würde Norbert Hirt eher in der Sparte Meisterprüfung verorten, sagt er.
Ramona Laufer hat sich durchgekämpft – und der Geschäftsführer ist stolz auf seine junge Mitarbeiterin.
Allein 150 Berichte sind in den drei Jahren entstanden, in jeder Woche im Betrieb einer. Darin hat sich die 25-Jährige mit unterschiedlichsten Themen rund um Bestattungen, Trauer, Formalitäten oder kulturellen Besonderheiten wie etwa muslimischen Bestattungen auseinandergesetzt.
Offenheit für Kulturen und Gepflogenheiten
Manche Betriebe fordern diese Berichte von ihren Auszubildenden nicht zwingend, weiß Hirt. Ihm sei es hingegen sehr wichtig, dass sich Nachwuchskräfte intensiv mit den Themen auseinandersetzen, die ihnen tagtäglich begegnen.
In einer multikulturellen Gesellschaft, in der sich zugleich auch das Bestattungswesen stark wandelt, sei es wichtig, sich mit unterschiedlichen Formen der Trauerkultur auseinanderzusetzen. Schon allein, um die Kunden umfassend beraten zu können.
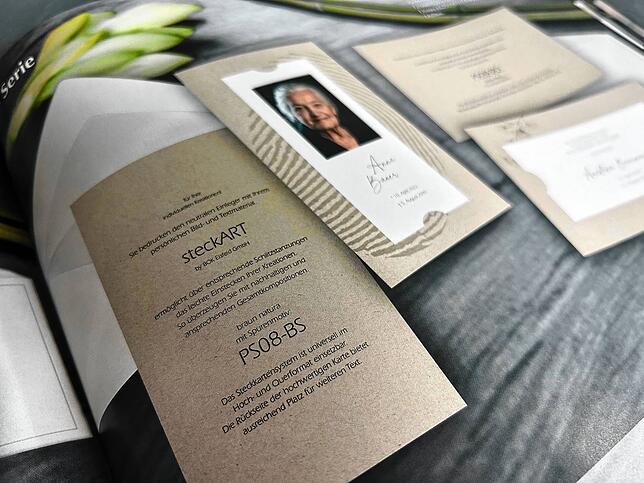
Zwar können auch Quereinsteiger ein Bestattungsunternehmen gründen – ein Gewerbeschein reicht theoretisch aus –, doch allein der Glaube, dass man sich in einer „krisenfesten“ Branche schon irgendwie halten könne, macht noch kein erfolgreiches Unternehmen aus.
Hilfsbereitschaft allein reicht nicht
„Es reicht nicht, wenn man gut mit Menschen umgehen kann und ihnen gerne hilft“, sagt beispielsweise Stephan Neuser, Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter, in einem Interview mit der „Deutschen Handwerkszeitung“.
Die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft ist wie die meisten Ausbildungen in Deutschland dual: Praxis- und Schulblöcke wechseln sich ab.
Im bayrischen Bad Kissingen befindet sich die Berufsschule. „Gesetze, Rechnungswesen, Materialkunde“, nennt Ramona Laufer einige Ausbildungsinhalte. Bürokratie macht einen großen Teil der Arbeit aus. Bei Auslandsüberführungen, aber auch bei Bestattungen vor Ort ist viel Schreibarbeit zu erledigen, Fristen müssen eingehalten und Formulare ausgefüllt werden.
Der Lehrfriedhof – ein Alleinstellungsmerkmal
Auf dem weltweit einzigen Lehrfriedhof im unterfränkischen Münnerstadt lernen die angehenden Bestatter die handwerklichen Seiten des Berufs: Etwa das Verlöten von Zinksärgen für Überführungen, aber auch das Ausmessen und Ausheben eines Grabes, sowohl mit dem Bagger als auch von Hand.
Auch Grabausheben will gelernt sein
Von Hand? Weil manche Friedhöfe so eng belegt sind, dass gar nicht gebaggert werden kann, muss eine Bestattungsfachkraft das auch ohne Maschine schaffen. „Man übt auf dem Lehrfriedhof im Zweierteam und muss zwar nicht zwei Meter tief graben, aber das ist schon sehr anstrengend“, sagt Ramona Laufer.
Da nicht alle Friedhöfe von Städten oder Gemeinden, sondern häufig von Bestattungsunternehmen betreut werden, müssen angehende Bestatter auch wissen, wie ein Grab ausgehoben wird, erklärt Norbert Hirt.
Der Abschied wird niemandem verwehrt
Nicht zuletzt ist da die Versorgung der Verstorbenen – also das Waschen, Ankleiden, Frisieren und sonstige Herrichten eines Leichnams für die Bestattung, ein Teil der Arbeit, der Ramona Laufer besonders interessiert.
Dass sie dabei auch Tote mit schlimmen Verletzungen sieht – damit kann sie umgehen. Selbst dann, wenn die Bestatter den Angehörigen auch manchmal empfehlen, den Toten oder die Tote nicht mehr anzusehen.
„Für die Angehörigen ist es wichtig, einen Abschluss zu haben.“Ramona Laufer, Bestattungsfachkraft
„Man darf niemand den Abschied verwehren“, sagt Ramona Laufer. Dann gelte es, offen und ehrlich zu sagen, was die Angehörigen erwartet – und dann zu schauen, dass man es irgendwie hinbekomme.
„Man kann zum Beispiel nur von einer Hand Abschied nehmen und das Gesicht mit einem Tuch bedecken“, nennt die junge Bestatterin ein Beispiel. „Für die Angehörigen ist es wichtig, einen Abschluss zu haben.“
Manche Fälle gehen jedoch auch an den Profis nicht spurlos vorbei. „Wir merken im Team sofort, wenn jemanden etwas beschäftigt, und dann sprechen wir“, sagt Ramona Laufer.
Eines schließt sie für sich momentan aus: Die Versorgung verstorbener Kinder oder Babys. „Dazu fühle ich mich noch nicht bereit“, sagt sie. „Und das ist kein Zeichen von Schwäche“, fügt Norbert Hirt hinzu. „Ganz im Gegenteil.“ Im Team reden, reden, reden, die Arbeit aber gedanklich nicht mit nach Hause nehmen – das sei essenziell.
Praktikum empfehlenswert
Generell empfiehlt Hirt, vor der Entscheidung über die Ausbildung ein Praktikum zu absolvieren. „Wir hatten schon Praktikanten, die bei der Versorgung eines Leichnams umgekippt sind“, sagt der Geschäftsführer.
Deshalb kritisiert er auch, dass die Versorgung eigentlich erst im dritten Ausbildungsjahr vorgesehen sei. Ramona Laufer durfte schon vorher dabei sein und unterstützen. „Schlimmstenfalls bildet man einen jungen Menschen zwei Jahre aus und im dritten Jahr bricht er ab.“







