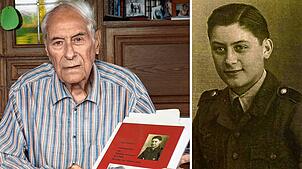Bis zu vier Mal pro Jahr finden in der Schweiz Volksabstimmungen auf Bundesebene statt. Am Sonntag ist es wieder soweit. Auf dem Programm steht unter anderem ein großes Streitthema: das Covid-19-Gesetz. Schon im Juni stimmten die Schweizer über die erste Fassung dieses Gesetzes ab, das im September 2020 in Kraft getreten war. Die Stimmberechtigten entschieden damals mit einer Mehrheit von 60 Prozent, dass das Gesetz bleiben darf.
In der Abstimmung am Sonntag, 28. November, geht es um die zweite, angepasst Fassung des Covid-19-Gesetzes, die der Schweizer Bundesrat im vergangenen Frühjahr überarbeitet hatte. Das bedeutet also, dass nicht das komplette Covid-19-Gesetz unserer Nachbarn auf der Kippe steht.
Finanzhilfen, Contact-Tracing und Covid-Zertifikat
Größter Streitpunkt dieser seit März geltenden angepassten Gesetze ist das sogenannte Covid-Zertifikat. In einer App wird mit einem QR-Code festgehalten, ob eine Person geimpft, genesen oder getestet ist. So werden in der Regel die 3G-Maßnahmen kontrolliert.
Die meisten Zugangsbeschränkungen, beispielsweise zu Veranstaltungen oder in der Gastronomie, basieren auf diesem Zertifikat. Es ist somit ein essenzieller Teil des Schweizer Pandemiemanagements. Auch Auslandsreisen werden durch das Zertifikat vereinfacht, weil es auch im EU-Raum gültig ist. Die Gegner des Gesetzes sehen darin eine Möglichkeit der Überwachung durch den Staat, die von Bundesseite aber klar verneint wird.
Weitere Änderungen des Gesetzes betreffen unter anderem das sogenannte Contact-Tracing, also das Verfolgen von Ansteckungsketten, oder auch, dass der Bund die Kosten für Tests übernehmen und diese fördern kann. Einen Vorteil bei dem Gesetz haben besonders geimpfte Menschen. Weil davon ausgegangen wird, dass von ihnen eine geringere Ansteckungsgefahr ausgeht, entfällt für sie die Quarantänepflicht bei einem Kontakt mit einer positiv getesteten Person.
„Nach Ansicht der Komitees führt die Gesetzesänderung auch zu einer Spaltung der Schweiz und zu einer massiven Überwachung von allen“, heißt es in einer Broschüre der Gesetzes-Gegner, die die Abstimmung initiiert haben.

Das denken die Menschen in Kreuzlingen
Die Gegenstimmen sind laut. Protesten gegen die Maßnahmen und aufwendigen Kampagnen gegen das Gesetz zum Trotz, weisen die aktuellen Umfragen aber darauf hin, dass das Gesetz wohl angenommen wird. In einer Umfrage von tamedia gaben zuletzt 68 Prozent an, für das Gesetz stimmen zu wollen. 31 Prozent seien gegen das Gesetz. Diese Haltung spiegelt sich auch bei einer Umfrage des SÜDKURIER am Mittwochnachmittag in den Kreuzlinger Straßen wider. Es wird aber deutlich, dass es um mehr geht als um ein einfaches Ja oder Nein.
Das macht auch Renate Lindenberg deutlich. Sie stammt ursprünglich aus Deutschland, ist mittlerweile aber Doppelbürgerin und lebt seit 2010 in Kreuzlingen – sie darf also Abstimmen. Das Problem: Sie könne die Argumente beider Seiten nachvollziehen. Deshalb sei sie noch unentschlossen, wie sie am Wochenende abstimmen werde. „Man muss beide Seiten sehen“, erklärt sie. Anders als bei den zwei anderen Abstimmungen vom Wochenende, zur Pflegeinitiative und zur Justiz-Initiative, sei beim Thema Covid noch nicht klar, ob am Ende ein JA oder ein NEIN auf ihrem Zettel stehen wird.
Nur wenige wollen das Thema diskutieren
Anders als Renate Lindenberg sieht es bei Claudia Rohr aus. Sie hat zwar eine klare Meinung zu dem Thema, darf als Deutsche, die in Kreuzlingen lebt, aber nicht abstimmen. Besonders der Vorwurf der Überwachung trifft bei ihr auf Unverständnis: „Man muss ja mittlerweile überall einen Zettel oder ähnliches ausfüllen. Das sind auch vertrauliche Daten und da fragt auch niemand nach“, sagt sie.

Besonders wünscht sie sich aber, dass mehr diskutiert wird. In ihrem Umfeld machte Rohr die Erfahrung, dass niemand mehr über das Thema sprechen wolle. „Wir müssen uns doch, trotzdem alle wieder miteinander verständigen. Wir sitzen am Ende alle im gleichen Boot“, so Rohr. Schließlich würden ja alle wollen, dass das Ganze irgendwann endlich vorbei ist.
Auch Melina Merk aus Tägerwilen hat den Eindruck, dass niemand mehr darüber sprechen will: „Man diskutiert schon gar nicht mehr darüber, weil es ein hitziges Thema ist und man kommt auf keinen Nenner“, erklärt sie. Merk hat ihren Zettel mit dem Nein schon eingeworfen. Zwar empfinde sie die bestehenden Maßnahmen als gerechtfertigt und ist auch selbst geimpft – ihre große Befürchtung sei aber, dass bei einem Ja weitere Maßnahmen hinzukommen könnten. Eine Befürchtung, mit der sie an diesem Tag nicht alleine ist.
Auch junge Menschen bewegt das Thema
Die Abstimmung geht auch an jungen Menschen nicht gänzlich vorbei. „Ich habe mich noch nicht so genau damit auseinandergesetzt, weil es mich nicht so betrifft“, sagt Ennio Loffreda. Er ist noch zu jung, um abzustimmen. Die Diskussionen in seinem Umfeld verfolgt er dennoch.
Er glaubt, dass es beim Ja oder Nein oft auf die Gesamthaltung ankommt. „Diejenigen die geimpft sind, tendieren eher zum Ja“, sagt er. Er und Lara Marsicano, mit der er gerade durch die Kreuzlingen schlendert, tendieren beide zum Ja, auch wenn nur Marsicano am Wochenende abstimmen darf.

Was Loffreda in seinem Umfeld beobachtet, bestätigen auch die Gespräche auf der Straße. Kaum jemand hat sich im Detail mit dem Gesetz auseinandergesetzt. Viel mehr spielt die Grundhaltung gegenüber Themen zur Pandemie eine Rolle. Auffällig ist, dass sich die Gespräche – egal ob die Person zu Ja oder Nein tendiert – an den Themen der Gesetzes-Gegner orientiert.
Mehr als einmal fallen die Worte Impfzwang oder Überwachung. Begriffe, die oft auf den Plakaten der Initiatoren des Referendums zu finden sind. Ob die Kampagne am Ende wirkt, und ob sich die Kreuzlinger Tendenz zum Ja auch auf Bundesebene bestätigt, wird sich erst am Sonntag zeigen, wenn alle Stimmen in den Wahlurnen des Landes liegen.