Hexen? Das sind heute skurrile Menschen in fantastischer Aufmachung oder freundliche Wesen aus dem Kinderbuch. In Berlin betätigt sich eine Influencerin als moderne „Hexe“. Die junge Frau gibt Tipps für Rituale, die sie als magisch beschreibt. Auch in der Fasnacht treiben Hexen ihr Unwesen – gekleidet in lange Röcke, versehen mit einem Runzelgesicht mit langer Nase und glühenden Augen. So richtig Angst hat niemand vor ihnen. Sie erzeugen, wenn überhaupt, ein leichtes Gruseln – ein wohliges Gefühl zwischen Harry Potter und Kräuterfrau.
Von dieser Leichtigkeit des Lebens konnten jene Frauen nur träumen, die vor vier oder fünf Jahrhunderten der Hexerei bezichtigt wurden und deshalb oft einen qualvollen Tod erleiden mussten. Bereits die Anklage war verheerend und ein Freispruch nur schwer möglich. Die Prozesse liefen nicht nach heutigen Kriterien ab. Die Frauen (nur wenige Männer waren der Hexerei bezichtigt) konnten sich nicht verteidigen. Sie standen ohne Beistand da.
Auch im Südwesten ging damals der Hexenwahn um. In einigen Orten mehr, wie zum Beispiel in Ravensburg, in anderen Orten weniger. Von 1484 bis etwa 1620 dauerte diese schwarze Ära im Bistum Konstanz. In anderen Territorien reichte die Verfolgung der verfemten Frauen bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Das ist erstaunlich.
Bis ins „Zeitalter der Aufklärung“ hinein wurden Mägde oder Witwen denunziert, vor Gericht gezogen und verurteilt. Der Hexenwahn ist kein Produkt des Mittelalters, das oft als finster bezeichnet wird. Er entsteht erst am Ende des Mittelalters. Kurz vor Beginn der Reformation zieht die Vermischung von Aberglauben und Verschwörungstheorien eine erste blutige Spur.
Ein fanatischer Mönch namens Heinrich
Ravensburg, Anno 1484. Der berüchtigte Heinrich Kramer kommt in die Stadt. Berüchtigt war der Dominikanermönch, weil er als besessener Verfolger aller Menschen galt, die von den Normen abwichen. Der Mönch Kramer (auch genannt Heinrich Institoris) ging offensiv und suggestiv vor. Gleich nach dem Einzug in die wohlhabende Reichsstadt forderte er die Bürger auf, verdächtige Menschen an ihn zu melden.
Hat da eine Frau geflucht? Ist danach ein Kind gestorben oder schlechtes Wetter aufgekommen? Vollzog sie magische Praktiken, die damals ohnehin noch gang und gäbe waren und von der kirchlichen Obrigkeit bisher hingenommen wurden, wenn sie nicht an die große Glocke gehängt wurden. Schon die Zubereitung eines Kräutersuds gegen Husten konnte Menschen in die Nähe der Hexerei rücken.

Heinrich Institoris hatte mit seiner Methode Erfolg. Denunziation auf der Grundlage von Neid und Missgunst funktioniert immer, nicht nur damals. In den engen Gassen der ummauerten Stadt wohnten genug Menschen, die persönliche Rechnungen offen hatten. Schnell wurden sechs Frauen vor das Sondergericht des Paters geschleppt. Sie wurden gefoltert und gedemütigt.
Zwei von ihnen kamen auf den Scheiterhaufen. Dieser Tod ist nicht nur besonders qualvoll, da das Opfer erstickt. Er ist auch symbolisch im Sinne einer Teufelsaustreibung: Durch das Feuer sollte die Seele gereinigt und damit gerettet werden, so ging der heute unverständliche Grundgedanke.
Der Auftritt des besessenen Paters Heinrich hatte Folgen. Institoris verfasste nach seinem Ravensburger Tribunal ein Handbuch für Inquisitoren – den „Hexenhammer“. In diesem Werk – eines der verhängnisvollsten der kirchlichen Literatur – werden die Abläufe eines Verfahrens genau beschrieben. Die Folter wird zum normalen Instrument, um die Frauen zum Reden zu bringen.
Der Bischof will nichts vom Hexenprozess wissen
Doch regen sich auch Widerstände. Institoris merkt das, als er nach dem Fanal von Ravensburg Richtung Süden reist, um in Innsbruck nach dem Rechten zu schauen, wie er meint. Schnell finden sich eine Handvoll Menschen, die aufeinander zeigen und sich der Hexerei bezichtigen. Doch in Innsbruck kommt es anders: Der zuständige Bischof von Brixen erklärt die Vorwürfe für Humbug und den Inquisitor für verrückt. Heinrich Institoris wird des Landes verwiesen. Er muss sich andere Länder suchen, deren Untertanen er für besessen hält.
Hier wird ein Muster deutlich, das sich durch diese Jahrzehnte zieht: In aller Regel kommt der böse Fingerzeig von unten. Es ist nicht die kirchliche Obrigkeit, die nach Menschen sucht, die mit dem Teufel im Bund stehen und die schlechtes Wetter bestellen.
Es sind auch nicht die weltlichen Herren und Fürsten, die den Deckel von den Töpfen in der Küche nehmen und nach Gift suchen.
Es sind die Nachbarn und die eigene Familie, in der gewöhnlicher Streit ausartet. Der unliebsame Schwager, die verwandte Witwe, sie werden der Hexerei bezichtigt. „Beschuldigungen gehörten damals zum Alltag“, schreibt der Historiker und Archivar Wolfgang Zimmermann in einem Aufsatz.
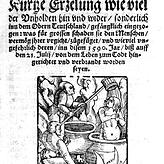
Ein Fall aus Markelfingen (heute Kreis Konstanz) macht dies deutlich. 1609 klagt das halbe Dorf eine Elsa Bierbömerin an. Sie stand im Ruf der Hexerei, ohne dass ihre Kläger das genau belegen konnten. Elsa war im Dorf isoliert und als Witwe schutzlos (die meisten angeklagten Frauen waren Witwen oder unverheiratete junge Frauen).
Sie habe das Schlechtwetter bestellt, das den Markelfingern manche Saat verdorben habe. Der bischöfliche Beamte und Obervogt auf der Reichenau lässt die Bierbömerin daraufhin festnehmen und verhören. Da er keine Beweise für Hexerei findet, schickt er sie nach Hause. Das Muster wiederholt sich: Während von unten denunziert wird, hat die Obrigkeit weder Grund noch Anlass, die Untertanen zu töten. Fake News hier – rationales Verwaltungshandeln dort.
Familien und Nachbarn fangen damit an
Der Historiker Zimmermann hat die einschlägigen Protokolle studiert, die aus dem Herrschaftsgebiet des Bischofs von Konstanz überliefert sind. Sie lagern heute im Generallandesarchiv in Karlsruhe (GLA). Die Situation, die er dort vorfindet, wiederholt sich. Die Hinweise auf magische Praktiken und kommen aus dem engsten Umfeld. „Us grosser hiz und zorn“, wie es in einem Protokoll heißt, hatte sich das Streitgespräch hochgeschaukelt. „Hitzig und im Zorn“ werden Dinge gesagt, die am anderen hängenbleiben wie zäher Leim – und zum Verhängnis werden.
Aberglaube war damals noch weit verbreitet. Dabei waren dunkle Praktiken toleriert, solange sie nicht zu auffällig waren und nicht publik wurden. Die Kirche ließ die Leute gewähren, sie hat selbst immer wieder Prozesse der Verschmelzung mit anderen Kulten durchlaufen. Heikel wurde es erst, wenn Okkultes vor den Augen der Gemeinschaft geschah.
Der Fall des Rudi Schellenbaur gehört dazu. Der Abt der Reichenau ließ ihn 1505 festnehmen, nachdem Schellenbaurs Tat bekannt geworden war: Er hatte ein Kleeblatt in ein Bett aus Wachs gepresst. Dieses Stück nahm er und legte es unter das Tuch, das den Altar der Markelfinger Kirche bedeckte. Damit wollte er etwas Heilkraft des Altars auf sein Kleeblatt übertragen, wollte es heiligen. Dennoch hatte er ein Sakrileg begangen. Und doch: Schellenbaur kam wieder frei.
Das kann auch damit zu tun haben, dass Männer bessere Chancen hatten, wenn es zum Prozess kam. Später waren es vor allem Frauen, die angeklagt wurden – von Männern, die das gesamte Personal vom Richter, Vogt und Scharfrichter abgedeckten. „Das Hexenbild verengt sich auf das weibliche Geschlecht“, stellt der Historiker Zimmermann fest.
Das hat auch mit dem Geschlecht des Teufels zu tun, das – fern aller modernen Identitätsdebatten – eindeutig männlich festgelegt war. Die Theorie dahinter: Nur vom Teufel konnten biedere Hausfrauen oder arme Witwen die Macht haben, das Leben anderer Menschen zu verändern. Der Schadenszauber ist deshalb der häufigste Vorwurf, der in den Protokollen auftaucht.
Die Hexe hat das Vieh verhext, die Nachbarin verflucht oder ein Gewitter bestellt. Bei der Abhängigkeit vom Wetter wog dieser Vorwurf schwer. Die Weitergabe von Geheimwissen oder die Zubereitung von verbotenen Getränken taucht in den Verhören im Bistum Konstanz dagegen selten auf.
Den heftigsten Punkt bildete die sogenannte Teufelsbuhlschaft. Sie geht von einem sexuellen Verhältnis zwischen Teufel und der von ihm verführten Frau aus. Männliche Inquisitoren schienen an diesem Punkt besonders interessiert und quälten die vermeintlichen Buhlschaften mit Detailfragen.
Im süddeutschen Raum kam der Wahn spät zum Stehen. Am 13. Juni 1782 wird die letzte Frau unter dem Vorwurf der Hexerei hingerichtet. Sie heißt Anna Göldi und wird in Glarus in der Schweiz durch das Schwert gerichtet; Glarus lag damals noch im Bistum Konstanz. Das Urteil vermeidet den Ausdruck „Hexe“. Göldi wird der Giftmischerei bezichtigt und stirbt als Giftmörderin.







