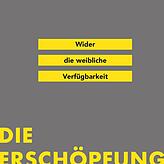Frau Schutzbach, was treibt Frauen heute in die Erschöpfung, wie Sie sagen?
Frauen haben viele Freiheiten erkämpft, sind erwerbstätig, in der Politik. Aber eines hat sich nicht verändert, dass sie immer noch für die Mehrheit der sogenannten Sorge- und Hausarbeit zuständig sind. Frauen sind heute sozusagen allzuständig: Sie sollen emanzipiert sein, finanziell selbständig, beruflich erfolgreich, selbstbestimmt. Gleichzeitig sollen sie ständig verfügbar sein für die Bedürfnisse anderer, für emotionale Arbeit, Hausarbeit, Pflege, Beziehung; für die Herstellung von Harmonie, Gemütlichkeit und Glück, dafür, dass andere sich von der harten Welt erholen können.

Sie sagen, dass neben den emanzipierten Rollenbildern heute, dass Frauen stark, selbstbewusst, schlau, aufgeklärt und gut gebildet sind, auch traditionelle Erwartungen unhinterfragt wirksam seien, die Frauen schaden. Welche meinen Sie?
Frauen sollen nach wie vor versorgen, behüten, putzen, perfekte Mütter sein. Das ökonomische System ist sexistisch: indem man Frauen diese Tätigkeiten als ihre „Natur“ zuschreibt, können sie als Gratisdienst vorausgesetzt werden, die „aus Liebe“ gemacht und nicht bezahlt werden müssen. Das ist sehr schlau und sehr ausbeuterisch, weil der Markt auf diese Weise für Millionen Stunden von Arbeit nicht aufkommen muss. Die Erschöpfung der Frauen ist kein Nebeneffekt, sondern Programm.
Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Situation im Zug, die Ihnen selbst mehrfach passiert ist. Sie sitzen im Speisewagen mit Kaffee und arbeiten am Laptop. Ein Mann verwickelt Sie in ein Gespräch und lässt nicht locker, obwohl sie immer wieder signalisieren, dass Sie weiterarbeiten wollen. Wie haben Sie sich gefühlt und schließlich reagiert?
Belästigung im öffentlichen Raum ist ein Symptom für die Ansprüche, die manche Männer gegenüber Frauen haben: Frauen sollen verfügbar sein. Die Haltung ist: Wenn ich gerade will, soll eine fremde Frau im Zug mir ihre Aufmerksamkeit geben. Ich zeige mit dem Beispiel, wie erschöpfend für Frauen selbst ein kurzer Aufenthalt in einem Zug sein kann. Frauen müssen sich ständig damit befassen, wie sie sich in Belästigungssituationen verhalten. Ich habe in dieser Situation nett reagiert, weil ich hoffte, dass der Mann mich dann in Ruhe lässt.
Wunsch und Wirklichkeit bei der Zeiteinteilung
Dieses „nette“ Verhalten nennt man „fawning“, was so viel heißt, sich wie ein süßes Rehkitz geben. Man weicht einem sexistischen Angriff aus, indem man sich freundlich gibt. Welche gesellschaftlichen Folgen hat ein solches Verhalten von Frauen?
Ja, fawning ist eine der Strategien, mit denen Frauen sich aus unangenehmen und bedrohlichen Situationen retten. Ich analysiere die verschiedenen Strategien um zu zeigen, wie riesig der Energieaufwand für Frauen ist, oft leisten sie diese „Arbeit“ ganz unbewusst. Aus meiner Sicht sollten wir aber beim Thema Belästigung über das Verhalten von Männern sprechen. Die Männer sind diejenigen, die ihr Verhalten ändern müssen, nicht die Frauen. Männer müssen ihre Erwartungen und ihr Konsumverhalten gegenüber Frauen hinterfragen.
Sie haben 2016 zusammen mit anderen den Twitter-Hashtag #SchweizerAufschrei nach dem Vorbild von #Aufschrei in Deutschland initiiert, um auf sexualisierte Gewalt und Belästigung aufmerksam zu machen. Inwiefern haben diese und die #MeToo-Bewegung den Blick und die Rolle von Frauen in der Gesellschaft verändert?
MeToo hat bewirkt, dass sich das Unrechtsbewusstsein stark verändert hat. Was früher noch als „normal“ galt, Übergriffe, von denen viele Frauen dachten, sie müssten sie ertragen, weil das zum normalen Alltagssexismus gehört, werden heute als Unrecht empfunden, skandalisiert und auch angezeigt. MeToo hat die Frauen selbstbewusster gemacht. Andererseits zeigt MeToo auch, wie schnell Emanzipation auf Hass und Gegenreaktionen stößt. Sobald Frauen ihre Stimme erheben und die Plätze verlassen, die man für sie vorgesehen hat, führt das zu massiven Gegenreaktionen. Emanzipation passiert nicht von selbst, sie muss unglaublich hart erkämpft werden und ist immer mit massiven Gegenbewegungen konfrontiert, auch das ist Thema meines Buches über „Erschöpfung“.
Gerade Frauen in der Politik sind in besonderen Maße Beleidigungen und anmaßenden Kommentaren in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. Welche Folgen hat das?
Es zeigt eine Gesellschaft, die Frauen immer noch stark abwertet, als weniger wert betrachtet, eine Gesellschaft auch, die Frauen strenger beurteilt als Männer, in der Frauen täglich um Geltung kämpfen müssen.
Inwiefern sehen Sie die Fixierung aufs Äußere, gerade bei jungen Frauen in den sozialen Medien, als Problem?
Nicht jede Inszenierung von Aussehen und Schönheit ist ein Problem. Selbstdarstellung in den Medien kann für Mädchen und Frauen sehr empowernd sein. Aber insgesamt gibt es einen enormen Druck, perfekt auszusehen, schlank zu sein. Ich sehe das als eine Art Backlash: die brutalen Schönheitsmythen sind eine Reaktion auf die Emanzipation der Frauen. Wenn sich die Fesseln der Frau lockern, werden neue energieabsorbierende Kontrolltechniken erfunden. Die Körper -und Schönheitsfixierung spitzten sich in dem Moment zu, in dem Frauen sich in vielen Bereichen einen gleichberechtigteren Platz erkämpft hatten.

Mit dem Muttersein sind viele Frauen hin- und hergerissen zwischen dem Kampf um Gleichberechtigung im Job und der plötzlichen Verantwortung für ein Baby. Wie ging es Ihnen persönlich damit?
Mich hat vor allem die radikale Pausenlosigkeit erschüttert, die die Verantwortung für Kinder erfordert. Das ist nicht kompatibel mit einer Berufswelt und einer Leistungsgesellschaft, die die Bedürftigkeit und Abhängigkeit von Kindern und anderen, zum Beispiel alten, kranken Menschen negiert.
Junge Väter wollen sich heute auch um ihre Kinder kümmern. Inwiefern kann aber eine geteilte Kinderbetreuung zwischen Männern und Frauen alte Ungleichheiten verstärken, obwohl sie eigentlich der richtige Ansatz ist?
Es ist eine gute Entwicklung, dass Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen und das auch tun. Oft wird aber, wenn Väter Zeit mit den Kindern verbringen, das zum Anlass genommen, dass dann die Frauen erst recht mehr im Haushalt machen und die Gesamtplanung und das Management für Familienabläufe bei den Frauen bleibt. Im Sinne von: Weil ich schon Zeit mit den Kindern verbringe, kann ich den Rest den Frauen überlassen.
Sorgearbeit und damit die Betreuung von Kindern und alten Menschen leisten meist Frauen. Gesellschaftlich honoriert wird das nicht. Auch beruflich bleibt diese Arbeit schlecht bezahlt. Was müsste sich ändern?
Die Systemrelevanz der Sorgearbeit muss endlich erkannt werden. Denn bevor in der Wirtschaft überhaupt etwas produziert werden kann, müssen ja erst mal Menschen geboren und großgezogen werden. Auch die Versorgung von alten und kranken Menschen ist die Basis einer gut funktionierenden Gesellschaft. Die professionelle Sorgearbeit in der Pflege muss deshalb besser bezahlt werden. Zweitens müsste die Erwerbsarbeit reduziert werden. Unser gesamtes Leben ist an der Erwerbsarbeit ausgerichtet, alle anderen Dinge werden vernachlässigt. Wir sollten es so einrichten, dass alle Menschen mit weniger Erwerbsarbeit genug Lohn zum Leben haben und genug Zeit, um andere Dinge zu tun. Mein Traum wäre eine Gesellschaft, in der Geldverdienen, das Versorgen von anderen Menschen, politisches Engagement und die Sorge um sich selbst gleich viel wert sind.