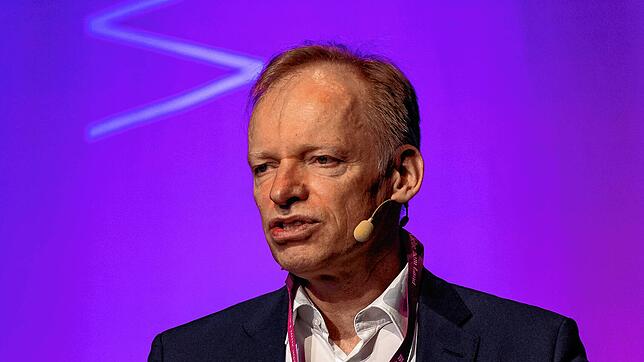Herr Fuest, Baden-Württembergs Wirtschaft ist 2024 deutlich stärker geschrumpft als der Bundesschnitt. Können Sie erklären, warum der Südwesten ins Hintertreffen gerät?
Clemens Fuest: Dass wirtschaftlich starke Bundesländer in Krisen besonders hart getroffen werden, ist nicht ungewöhnlich. Ein gutes Beispiel ist die globale Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008. Auch damals brach die Wirtschaft dort überdurchschnittlich stark ein. Dennoch ist die Lage aktuell für Baden-Württemberg bedrohlicher als damals.
Warum?
Wichtige Industriezweige stecken neben den konjunkturellen Schwierigkeiten nun zusätzlich in einer Strukturkrise, die sich als hartnäckig erweist. Allen voran die Automobilbranche, die im Südwesten eine sehr hohe Bedeutung hat.
Jahrzehnte hat man in Baden-Württemberg von der Automobillastigkeit profitiert. Beginnend mit der Dieselkrise und sich verstärkend durch den Übergang zur Elektromobilität und zur Digitalisierung im Fahrzeugbereich ändert sich das. Die Probleme der Branche schlagen voll auf die lokale Wirtschaft durch.

Die beschäftigungsstärkste Industriebranche in Baden-Württemberg ist mit knapp 300.000 Mitarbeitern der Maschinenbau. Auch er steckt in der Dauerrezession. Welche Erklärungen gibt es hier?
Hier schlägt neben Faktoren wie der Zollpolitik der USA vor allem durch, dass das bisherige Geschäftsmodell heimischer Unternehmen, sich durch technologische Spitzenprodukte global unverzichtbar zu machen, unter Druck gerät. Vor allem chinesische Konkurrenten der Maschinenbauer haben teilweise derart aufgeholt, dass der Wettbewerbsvorteil deutscher Hersteller dahin ist.
Aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur hat der Südwesten Krisen in der Vergangenheit zwar früher zu spüren bekommen als andere Teile Deutschlands, es ging aber oft auch wieder schneller aufwärts. Besteht diese Option heute auch?
Die Chance besteht, aber man darf die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Das hat damit zu tun, dass wir einen dauerhaften Strukturwandel in ganz Deutschland sehen. Investitionen in Produktionsstätten gehen zurück, diejenigen in Forschung und Entwicklung steigen.
Davon profitiert der klassische Maschinenbau-Mittelständler oder Automobil-Zulieferbetrieb aber nicht. Wir müssen damit rechnen, dass eine Rückkehr zur Zeit vor 2019 mit hohen Investitionen in die Produktion nicht mehr stattfindet. Damit kommen auch die Jobs nicht zurück.

Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahren zehntausende an Industriearbeitsplätzen verloren. Wird sich diese Entwicklung fortsetzen?
Ich erwarte, dass dieser Trend sich verlangsamt, aber er wird nicht verschwinden. Die heimischen Unternehmen investieren zusehends nicht mehr in Deutschland, sondern gehen mit ihrer Produktion in die Länder, in denen sie die Produkte auch absetzen.
Das hat mit Dingen wie Protektionismus auf globaler Ebene zu tun, aber auch mit politischen Unsicherheiten und hohen Kosten am Heimatstandort. Neue Jobs in Deutschland entstehen seit Längerem nicht mehr in der Industrie, sondern eher in Bereichen wie Gesundheit, Pflege und in der öffentlichen Verwaltung.
Das sind alles Bereiche, in denen nicht die hohen Industrielöhne bezahlt werden…
…. und in denen die Produktivität und das Produktivitätswachstum nicht so groß ist wie in der Industrie. Die Folge ist eine geringere Wertschöpfung auf nationaler Ebene.
Das hört sich an, als ob es schwierig ist, die Welle der De-Industrialisierung, die über uns hinweg schwappt, zu brechen?
Fakt ist, dass es in Deutschland mittlerweile zu viele Faktoren gibt, die Produktivität und Investitionen hemmen. Zu viel Bürokratie und Regulierung, Unsicherheit über Energieversorgung und zu hohe Steuern und Abgaben. Das sind alles Punkte, die im Moment gegen den Standort Deutschland sprechen.
Baden-Württembergs ewiger Sparringspartner in Sachen Wirtschaft ist Bayern. Zuletzt schien Bayern erfolgreicher, etwa mit Blick auf die Ansiedlung internationaler Konzerne. Was macht Bayern anders?
Bayern hat ab den 1990er Jahren sehr stark in Technologie investiert. Dazu kam ein perfektes Marketing in eigener Sache, Stichwort: Laptop und Lederhose. Heute profitiert Bayern von einem dynamischen Großraum München mit sehr guten Universitäten und Hochschulen und sehr vielen Ansiedlungen in Hightech-Bereichen.
Allerdings übertrifft Baden-Württemberg Bayern bei den Forschungsausgaben. Mit über fünf Prozent Anteil an der Wirtschaftsleistung ist der Südwesten bundesweit hier die Nummer eins. Es gibt auch eine ungeheure Stärke im Mittelstand und anders als in Bayern eher in der Fläche.
Allerdings stehen wir nicht primär in einem Wettbewerb zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Im Wettbewerb stehen wir eher auf globaler Ebene mit dem Silicon Valley, dem Großraum London oder China. Bayern und Baden-Württemberg sollten daher ihre Kräfte noch viel stärker bündeln, damit wir in Sachen Innovationskraft mithalten können. Die Rolle der Hochschulen ist hier entscheidend.

Was ist ihre Rolle?
Wir müssen uns Gedanken machen, ob die Hochschulen für die Transformation Deutschlands richtig aufgestellt sind. Der Gedanke, dass an Unis nur geforscht wird und der Rest der Republik den Aufbruch in die neue Zeit übernimmt, wäre jedenfalls grundfalsch. Ich glaube, die kritische Frage, ob das, was in unserer Hochschullandschaft erforscht wird, auch einen realen Nutzen erzeugt, muss man intensiver stellen.
Forschungsfreiheit hat aber Verfassungsrang...
Die gesamte Forschung an der Wirtschaft auszurichten, ist falsch. Das will auch niemand, denn ohne Freiheit gibt es keine Spitzenforschung. Es geht aber schon darum, mehr Lehrende und Studierende an Universitäten auch für Unternehmertum und die wirtschaftliche Verwertung von Ideen zu interessieren.
Manches Bundesland im Norden Deutschlands ist wirtschaftlich derzeit erfolgreicher als die Südländer. Deutet sich hier ein Trend an?
Es deutet sich an, dass der große wirtschaftliche Vorteil, den Länder wie Baden-Württemberg und Bayern bislang hatten, schmilzt. Das betrifft aber vor allem den Bereich der Energie, wo neue Erzeugungsanlagen für Erneuerbare Energien oft nicht in Süddeutschland gebaut werden.
Klar ist, dass ausreichend Energie auch ein wichtiger Punkt bei der Ansiedlung von Unternehmen ist. Gesamtdeutsch betrachtet wäre es gar nicht schlecht, wenn es hier zu einer Annäherung zwischen Nord und Süd kommt.
Mit einer Schulden- und Investitionsoffensive für die Unternehmen versucht die Bundesregierung gerade, die Schalter auf Wachstum umzulegen. Wird das gelingen?
Schulden aufnehmen kann jeder. Viel wird jetzt davon abhängen, ob die Politik das Geld richtig einsetzt. Die neuen Schulden machen nur Sinn, wenn sie in Investitionen fließen.
Im Moment deutet sich leider an, dass viele dieser Mittel in den Konsum umgeleitet werden. Konsum auf Pump, wird das Wachstum auf Dauer aber belasten. Ergänzend sind Reformen nötig, etwa im Bereich des Arbeitsmarkts. Es bringt nichts, wenn all die neuen Brücken und Rechenzentren nicht gebaut werden können, weil niemand da ist, der sie errichtet. Und wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren, sonst wird das viele Geld am Ende gar nicht abgerufen.
Die Verbraucher üben sich in Konsumzurückhaltung. Braucht es mehr Anreize?
Das ist nicht unser Hauptproblem. Die verfügbaren Einkommen sind in den letzten Jahren trotz Inflation gestiegen. Die Leute sparen das Geld aber. Und das hängt stark mit der Unsicherheit und allgemeinen Stimmung im Land zusammen.

Es ist vor allem der Export, der seit Jahren einfach nicht in Gang kommt. Woran liegt das?
Unsere Produkte sind zu teuer und entsprechen nicht mehr dem, was die Welt haben will. Natürlich behindert der zunehmende Protektionismus den Welthandel. Allerdings ist der Welthandel in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als der deutsche Export. Wir verlieren also Marktanteile und machen daher irgendetwas falsch.
Schon vor einiger Zeit haben Sie mit Blick auf enorme Verteidigungsausgaben gesagt: „Kanonen und Butter – das wäre schön, wenn das ginge. Aber das ist Schlaraffenland.“ Brauchen wir also Kanonen ODER Butter, also Sozialausgaben?
Teile der Politik haben bei der Diskussion über stark steigende Rüstungsausgaben den Eindruck erweckt, dafür müsse niemand auf etwas verzichten. Das ist falsch, sonst hätten wir die Bundeswehr nicht so stark schrumpfen lassen. Wenn man aufrüstet, muss man irgendwann auf anderes verzichten.
Bei den Vorschlägen, wo gespart werden soll, dreht es sich fast immer um Sozialausgaben. Das Elterngeld oder die Rente mit 63 sind Beispiele. Warum wird so wenig über eine stärkere Besteuerung der Vermögenden geredet?
Die Frage, von welchen Teilen der Bevölkerung Opfer verlangt werden müssen, ist keine wissenschaftliche. Das zu bestimmen, ist Aufgabe der Politik und hat mit Anschauungsfragen zu tun. Wenn sich die Politik aber auf die Fahnen schreibt, das Wirtschaftswachstum zurückzubringen, dann muss man bei den Staatsausgaben und der Umverteilung ansetzen und beides zurückfahren.
Steuererhöhungen, etwa die Einführung einer Vermögenssteuer, führen im Gegenteil zu weniger Investitionen und damit zu weniger Wachstum. In entwickelten Gesellschaften wie Deutschland besteht in den meisten Fällen ein Konflikt zwischen Wachstum und Umverteilung. Die Politik muss zwischen diesen Zielen immer wieder abwägen.
Sie sind viel im Ausland unterwegs. Wie wird Deutschland da gesehen?
Die deutsche Energiewende wird mit sehr viel Unverständnis gesehen. Da ist der Tenor: Die Deutschen sind doch eigentlich vernünftig, warum sind sie in diesem Punkt so extrem und speziell? Gleichzeitig erwartet man, dass Deutschland jetzt mal wieder in die Spur kommt.