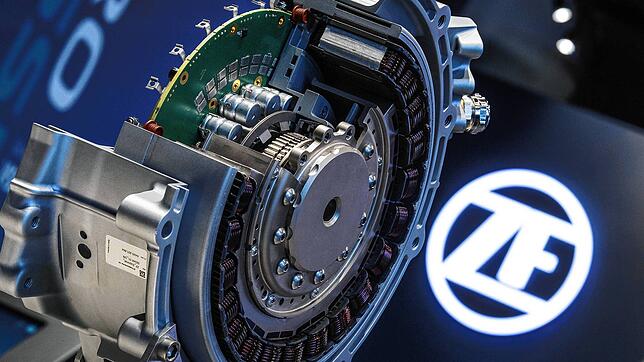Die Frühaufsteher bei ZF hatten ihr Mittagessen in den Betriebskantinen von Deutschlands zweitgrößtem Automobilzulieferer ZF noch wie gewohnt zu sich nehmen können. Um kurz vor zwölf Uhr hatte sich die Nachricht vom größten Stellenabbau in der Geschichte des Friedrichshafener Getriebebauers noch nicht herumgesprochen.
Am Mittag war die Nachricht im Intranet
Das änderte sich schlagartig, als ZF die Nachricht zur Mittagszeit ins Intranet stellte. Bis dahin waren nur der 20-köpfige Aufsichtsrat des Unternehmens und ein kleiner Kreis an Managern eingeweiht, wie es aus Unternehmenskreisen heißt.
Zwei Tage lang, am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche, hatte der ZF-Aufsichtsrat unter der Führung von Chefkontrolleur Heinrich Hiesinger getagt und einen der wohl größten Einschnitte der Unternehmensgeschichte beraten. Am Ende stimmte das Gremium zu.

Es kommt dicker als erwartet
Zwischen 11.000 und 14.000 Stellen sollen in Deutschland bis Ende 2028 wegfallen – das ist rund ein Viertel aller heimischen Arbeitsplätze und übertrifft in seiner Dimension selbst die seit Monaten kursierenden Gerüchte zu Jobstreichungen deutlich.
Von bis zu 12.000 Arbeitsplätzen war bisher die Rede – und zwar zeitlich stärker gestreckt bis ins Jahr 2030 hinein. Bestätigt hatte das Unternehmen diese Zahlen nie. Seit Freitag herrscht nun auch öffentlich Klarheit: Es kommt noch dicker.

ZF steht unter Druck
ZF steht unter Druck. Die Schulden sind hoch und die Zinslast ist 2023 stark angestiegen. Unter dem Stich ist der Konzerngewinn 2023 auf gerade mal noch 126 Millionen Euro zusammengeschrumpft.
„Unsere unternehmerische Verantwortung ist, ZF zukunftsfähig auszurichten und die Standorte in Deutschland so weiterzuentwickeln, dass sie nachhaltig wettbewerbsfähig und solide aufgestellt sind“, sagte der seit Anfang 2023 amtierende ZF-Chef Holger Klein.
Dazu müsse man auch „schwierige, aber notwendige Entscheidungen treffen“. Es gehe darum, bestmögliche Lösungen für alle Beteiligten zu finden.
Betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen
Wie die aussehen sollen, ist noch unklar. Laut ZF soll der Jobabbau soweit möglich sozialverträglich ablaufen. Betroffenen Mitarbeitern sollen Angebote zur Altersteilzeit gemacht werden.
Auch Abfindungsprogramme stehen im Raum. Betriebsbedingte Kündigungen wollte ein ZF-Sprecher gegenüber dem SÜDKURIER nicht ausschließen. Einen diesbezüglichen Plan gebe es aber explizit nicht, sagte er.
Bleiben Werke auf der Strecke?
Außerdem könnte die Zahl der Standorte in Deutschland weiter sinken. Nach den Zukäufen von TRW und Wabco im vergangenen Jahrzehnt hat ZF im Heimatmarkt rund drei Dutzend Standorte, zu denen teils mehrere Werke gehören. Dieses Sammelsurium solle nun konsolidiert und „zu mehreren Standortverbünden zusammengeführt werden“, wie ZF-Produktionsvorstand Peter Laier sagte.
Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. Klar ist aber, dass ZF unter Vorstandschef Klein die Schließung von Werken eingeleitet hat. Den Anfang machen Gelsenkirchen und Eitorf. Dort wird die Produktion in den kommenden Jahren dichtgemacht.
Im Ausland geht ZF diesen Weg schon länger. So wurden Werke in den USA, aber auch in Frankreich bereits geschlossen. Im Fokus des aktuellen Streichungs-Programms – internes Kürzel: „Projekt Deutschland“ – steht aber der Heimatmarkt.
Besonders im Saarland und in Bayern steigt nun die Nervosität. In Saarbrücken ist ZFs größtes Werk für Pkw-Getriebe mit rund 9000 Mitarbeitern angesiedelt, das seit einiger Zeit auch Schaltboxen für Hybridfahrzeuge fertigt. Hier läuft der Absatz aber schleppend.
Im bayrischen Schweinfurt wiederum befindet sich das konzernweite Kompetenzzentrum für Elektromobilität. Und auch hier häufen sich die schlechten Nachrichten.
„Der gute Wolf-Henning hat uns da ein gehöriges Erbe hinterlassen“

Denn der Markt für E-Fahrzeuge ist eingebrochen. Um die wenigen Stückzahlen, die von den Autobauern abgerufen werden, herrscht ein beinharter Preiswettbewerb. In der Branche ist es ein offenes Geheimnis, dass sich mit vielen E-Aufträgen kein Gewinn erzielen lässt. ZF trifft dies in besonderem Maße.
Kleins Vorgänger auf dem ZF-Chefsessel, der Ex-Mahle-Manager Wolf-Henning Scheider, hatte in seiner Amtszeit zwar hohe Auftragseingänge für die E-Mobilität vermeldet. Jetzt wird aber deutlich, dass sie oft zu unvorteilhaften Konditionen abgeschlossen wurden.
„Der gute Wolf-Henning hat uns da ein gehöriges Erbe hinterlassen“, sagt einer, der ihn lange kennt, aber lieber nicht genannt werden will. Ein anderer Insider sagt, viele E-Aufträge seien „unter Wasser“.

Die einst mit viel Geld hochgezogene Elektromobilitätssparte, die zudem den Abgang ihres Sparten-Chefs Stephan von Schuckmann zu verkraften hat, ist zum Sorgenkind mutiert. Folglich stellt sie der Konzern nun unter eine besondere Prüfung. Dabei erwägt man laut ZF „Kooperationen“ oder Technologie-Partnerschaften.
Selbst der finanzielle Einstieg eines anderen Unternehmens ist laut einem ZF-Sprecher möglich. Blaupause könnte hier das Airbag-Geschäft von ZF sein. Dieses hat der Stiftungskonzern ausgegliedert und sucht nur einen Partner.
Auch ein Börsengang ist möglich. Anders als die Airbag-Sparte ist das ZF-Elektromobilitätsgeschäft aber margenschwach und für potenzielle Käufer daher eher unattraktiv.
Friedrichshafen wegen Nutzfahrzeugen stabiler
Dem Friedrichshafener Stammsitz kommt zugute, dass hier neben der Verwaltung und Teilen der Forschung das Nutzfahrzeuggeschäft angesiedelt ist, das sich derzeit stabiler als der Pkw-Bereich zeigt.
Hinter den Kulissen heißt es daher, bei den Stellenstreichungen in der Produktion stehe der Stammsitz nicht an erster Stelle. Offiziell äußert sich ZF nicht.
Von der Arbeitnehmerseite hagelt es indes Kritik. „Die Unternehmensspitze hat ZF durch strategische Fehleinschätzungen und missglückte Finanzierungsmodelle bei Zukäufen in eine schwierige Lage gebracht“, sagte Horst Ott von der IG Metall Bayern. „Für diese haarsträubenden Managementfehler sollen die Beschäftigten jetzt den Kopf hinhalten.“
Ähnlich äußerte sich ZF-Gesamtbetriebsrat Achim Dietrich. Anstatt die Ursachen für die Krise anzugehen, lenke der Vorstand von „Manager-Versagen“ ab. Gewerkschaft und Betriebsrat kündigten „erbitterten“ Widerstand an.
Die Ankündigung der Stellenstreichungen schüre Ängste, wo man doch „Einsatz für die Belieferung der Kunden, der Bewältigung der Rezession und der Transformation“ brauche, sagte Dietrich.