Wenn Deutschlands zweitgrößter Automobilzulieferer ZF am Donnerstag in Friedrichshafen seine Bilanz vorlegt, wird eine Frage im Vordergrund stehen: Wie viel Gewinn bleibt bei dem milliardenschweren Stiftungskonzern unter dem Strich hängen?
An ZF hängt ein Teil des Wohlstands der Region
Die Frage ist keine technische, sondern sie entscheidet über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und wird ganz praktische Auswirkungen haben – auf die Region, die Beschäftigung und damit dem Wohlstand im südlichsten Winkel der Republik. ZF ist mit rund 10.000 Mitarbeitern allein in Friedrichshafen der wichtigste Industriebetrieb weit und breit. Seine Gewinne fließen über die Zeppelin-Stiftung in Pflegeheime, Kindergärten, Schulen und Schwimmbäder in der gesamten Region. Hunderte Zulieferer – von der Metzgerei um die Ecke bis zum High-Tech-Mittelständler sind darauf angewiesen, dass ZF unter Dampf steht.
Steht das sechste Krisenjahr vor der Tür?
Der 165.000-Mitarbeiter-Konzern aber hat fünf Krisenjahre hinter sich, und im Moment deutet wenig auf einen Umschwung hin. Aus dem Unternehmen heißt es, in den ersten drei Monaten sei man extrem schwach gestartet. Die Bestellungen bewegten sich auf dem Niveau von Mitte der 1990er Jahre. Schon jetzt ist klar, dass es schwer bis unmöglich wird, ans Auftragsniveau des vergangenes Jahres anzuknüpfen. ZF-Chef Holger Klein sagt, ZF stehe vor einem „sehr harten Jahr“.

In dieser Situation bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf die Bremse zu treten. Während sein Vorgänger Wolf-Henning Scheider seinen Job mitten in der Hochkonjunktur antrat, den Umbau des Konzerns scheute und anstatt dessen die Vision verfolgte, ZF mit viel Geld zum Systemanbieter in Sachen Mobilität auszubauen, hat Klein weitaus ungünstigere Voraussetzungen.
Er hat das Ruder vor gut einem Jahr mitten in der Krise übernommen. Seitdem steht seine Jobbeschreibung unter dem Motto: Kosten senken und das Unternehmen aufs Kerngeschäft und Rendite trimmen. „Wir haben mehr Ideen als Geld“, sagt Klein lapidar.
ZF trennt sich von Konzernteilen und will die Beschäftigung im Inland senken
Schon heute hat er mehr harte Entscheidungen getroffen, als sein Vorgänger in dessen gesamter Amtszeit. Aus dem Bau von Lidar-Sensoren – eine Schlüsseltechnologie fürs autonome Fahren – ist ZF ebenso ausgestiegen wie aus der Entwicklung selbstfahrender Shuttle-Busse.
Das Achsgeschäft wird hälftig an den Apple-Zulieferer Foxconn verkauft. Und für die Airbag-Sparte ist ein Börsengang geplant. Klar ist auch, dass zwei deutsche Werke geschlossen werden. Bis 2026 will Klein sechs Milliarden Euro Kosten einsparen. Eine Rosskur, die dem hoch verschuldeten Konzern Luft zum Atmen verschaffen soll.
Diese ist nämlich dünn geworden. Denn die Gewinne schmelzen dahin. Bei der Umsatzrendite ist ZF weit vom eigenen Ziel entfernt – ein Schicksal, das das Unternehmen mit den Konkurrenten – von Bosch über Conti bis Schaeffler – teilt.
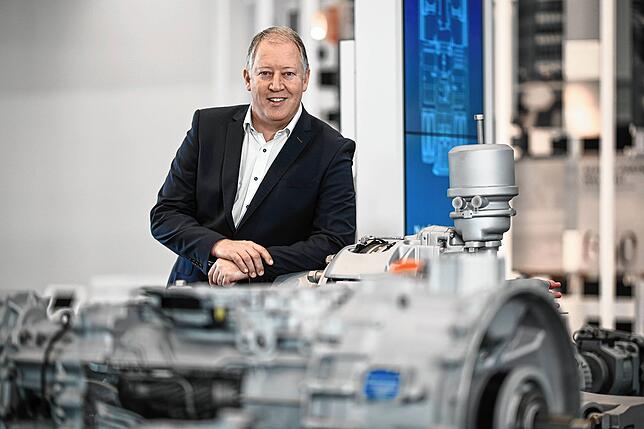
Sie alle stehen vor der Herausforderung, parallel zum Verbrennergeschäft den Ausbau von Elektromobilität, Software und KI finanzieren zu müssen. Dass mit den meisten Produkten für E-Autos noch kein Geld verdient wird, ist in der Branche ein offenes Geheimnis. Es fehlen die Stückzahlen. Und die Konkurrenz aus China ist viel stärker als in der alten Kolben- und Getriebewelt. US-Tech-Firmen wiederum dominieren bei Software, Chips und Betriebssystemen, die künftig immer mehr Wertschöpfung abdecken.
Die entscheidende Frage ist, wie viel vom Kuchen für die deutschen Zulieferer am Ende bleibt. Klar ist jetzt schon, dass das Stück kleiner werden wird. Und das trifft auch die Mitarbeiter. Laut Betriebsrat stehen bei ZF bis 2030 in Deutschland 12.000 Stellen zur Disposition.
Job- und Standortsicherungen gibt es, wenn überhaupt, nur bis ins Jahr 2026. Damit hat das Management eine zentrale Transformationsaufgabe bislang nicht erfüllt. Sie lautet: Den Belegschaften eine klare Perspektive zu geben, wie es langfristig weitergeht. Das sollte jetzt schnell geschehen.







