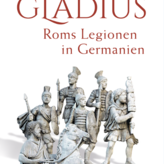Herr Fischer, was sind denn die kulturellen Geschenke der Römer, die sie nach Germanien mitgebracht haben und von denen wir heute noch profitieren?
An erster Stelle sehen viele das Christentum, das die Römer zunächst als eine von mehreren ihrer religiösen Kulte mitgebracht haben. Dann ist vieles, was wir mit Zivilisation und Kultur verbinden – seien es Straßen, Brücken, Warmluftheizung, Badegebäude oder Theaterbauten – römischen Ursprungs. Dazu gehört das Bauen mit Steinen und Ziegeldächern, was den Germanen unbekannt war, über die Garten- und Obstgartenkultur und den Wein bis hin zur Schrift.
Warum haben die germanischen Stämme keine Schrift ausgebildet?
Die Schriftlosigkeit der Germanen ist noch immer eines der großen historischen Rätsel. Es haben ja sehr viele Germanen seit dem 1. Jahrhundert in der römischen Armee gedient und dazu mussten sie auch die lateinische Schrift lesen und schreiben können. Sie waren also zumindest zeitweise mit Schrift befasst. Aber wenn sie dann nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst in die alte Heimat zurückkehrten, übten sie die gelernte Schriftkultur nicht mehr aus. Den Grund kann man sich immer noch nicht erklären.

Vielleicht eine gewisse germanische Sturheit und Bildungsabstinenz?
Vielleicht. Ein Beispiel: Die Kelten, die ja überwiegend im heutigen Frankreich lebten, das von Julius Caesar erobert worden war, zahlten jeden Preis, um an den Wein der Römer zu kommen. Das könnte auch erklären, warum Frankreich noch heute dem Wein so zugewandt ist. Im keltischen Kulturraum liegen massenweise Wein-Amphoren in der Erde, im germanischen gar nicht. Dort hat man weiter Bier und Met getrunken, obwohl vormalige germanische Legionäre den Wein bei den Römern kennengelernt hatten.
Die römische Reiterei bestand zum Großteil aus Germanen, es gab auch germanische Infanterieeinheiten im römischen Heer. In der Spätantike schließlich bestand ein großer Teil der römischen Armee aus germanischen Söldnern. Gab es zwischen Römern und Germanen ein Geben und Nehmen?
Ja. Gerade für das Militär gibt es da eine Menge Beispiele. Schon Caesar im 1. Jahrhundert vor Christus hat als Erster germanische Reiter – etwa beim Stamm der Ubier – rekrutiert und sie dann im Gallischen Krieg und auch später im Bürgerkrieg in der Mittelmeer-Regionen eingesetzt. Die römische Infanterie kämpfte im ersten und 2. Jahrhundert nach Christus mit dem Gladius, dem zweischneidigen Kurzschwert; die Germanen hatten einschneidige Kurzschwerter.

Später aber übernahmen die Germanen von den Römern das Langschwert, die Spatha. Die wurde zunächst von den berittenen Hilfstruppen der Römer, aber auch von der germanischen Adelsreiterei eingesetzt. Später übernahm auch die römische Infanterie die Spatha. Nun kämpften auch die germanischen Fußtruppen mit römischen Langschwertern. Schließlich haben die Germanen im Bereich der Kampfesweise und Taktik stets von den Römern dazugelernt. Aber es gibt auch ein paar umgekehrte Beispiele: In der Zeit nach den Markomannenkriegen Ende des zweiten Jahrhunderts gestalteten römische Legionäre ihre Gürtel nach dem Vorbild germanischer Waffengurte, auch germanische Typen von Speerspitzen fanden nun Verwendung bei der römischen Armee.
Immerhin hielten die Römer rund 400 Jahre dem germanischen Ansturm stand und verteidigten ihr Territorium an Rhein und Donau. Was haben sie richtig gemacht, dass sie so lange hier die Macht ausübten?
Die größte Stütze Roms eine hervorragend ausgebildete und bewaffnete Berufsarmee. Diese war gut versorgt und konnte sich auf befestigte Lager stützen, deren Reste wir noch heute am Limes sehen. Es gab dort heizbare Unterkünfte, Bäder, Vorratslager, Waffenkammern und sogar Lazarette. Dadurch, dass die Legionäre stets gut gedrillt waren und ihre Taktik immer anpassten, waren sie den Germanen über Jahrhunderte überlegen – obwohl sie stets zahlenmäßig unterlegen waren.
Dennoch gelangen den Cheruskern, Markomannen und später auch den Goten Siege gegen die Römer – weil die auf dem falschen Fuß erwischt wurden?
Das hat auch viel mit römischer Arroganz zu tun. Bestes Beispiel ist die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9, als der Feldherr Quintilius Varus seine Truppen über- und die aufständischen Germanen des Cheruskerhäuptlings Arminius unterschätzt hat.
War die Varusschlacht – von heute her betrachtet – nicht eine Katastrophe für die deutsche Geschichte, weil man ohne den Sieg der Cherusker von den Römern viel mehr hätte lernen können?
Gut, das ist natürlich eine Frage des Standpunkts. Es fehlte aber nicht viel und dann wäre Deutschland vermutlich bis zur Elbe und nicht nur bis zu Rhein und Donau romanisiert worden. Aber auch dann wäre es unklar, ob das römische Reich auch überlebt hätte. Da kann man trefflich spekulieren: Es gibt einen amerikanischen Science-Fiction-Roman von Kirk Mitchel namens „Procurator“. Der geht davon aus, dass die Römer die Varusschlacht gewonnen haben, und Pilatus Christus begnadigt hat. Deshalb gibt es in diesem Buch das römische Reich heute noch (lacht). Aber gut, wir wissen ja, dass es anders war: Die germanischen Stämme drängten stets aus dem Norden und dem Osten nach Süden, und man weiß nicht, ob ein größeres Römer-Reich diesem Druck hätte standhalten können.

Römer und Alamannen sind ja auch mehrfach aneinander geraten. Was wollte dieser germanische Stamm?
Die Alamannen waren ein junger germanischer Stamm, erst im dritten Jahrhundert schlossen sie sich, wie etwa auch die Franken oder Sachsen, aus kleineren, zunächst zerstrittenen Stämmen zusammen. Diese größeren Verbände hatten bei Plünderungszügen in das römische Reich viel mehr Aussicht auf Erfolg! Einer davon waren die Alamannen, deren Name „Männer aus allen Richtungen“ bedeutet. Aus Nord- und Ostdeutschland kommend, haben sie sich im südlichen Limesgebiet und im Schwarzwaldgebiet festgesetzt, spielten aber ein doppeltes Spiel.
Inwiefern?
Sie stellten einerseits Soldaten für das römische Heer und übernahmen in der Spätantike des Grenzschutz gegen andere germanische Stämme. So waren am spätrömischen Limes am Oberrhein oder im heutigen Bayern ein Großteil der römischen Grenzsoldaten Alamannen. Andererseits traten sie auch als Gegner Roms auf. Ein Beispiel: Als um die Mitte des 4. Jahrhunderts die römische Armee aus Gallien abgezogen wurden, um gegen die Goten auf dem Balkan zu kämpfen, kam ein alamannischer Soldat der römischen Palastwache in Trier auf Urlaub nach Hause mit der Nachricht, die Römer seien fort und man könne jetzt zu Raubzügen starten. Was dann auch passierte.
Was war die Ursache für den Untergang des römischen Reichs?
„Untergang“ ist ein Schlagwort, das außer Acht lässt, dass die meisten Menschen die Umbrüche ja überlebt haben, so wie wir Menschen kennen, die noch die Weimarer Republik und das Dritte Reich erlebt haben. So gab es auch in der Zeit der Spätantike und des frühen Mittelalters zwar einen grundlegenden Wandel des politischen Systems und einen Wechsel der Machteliten, aber kein Aussterben größerer Bevölkerungsteile. Der Druck auf das römische Reich im Mehrfrontenkrieg gegen Perser, Germanen, Hunnen und andere Völker war schließlich so groß, dass man nicht mehr das ganze Reichsgebiet verteidigen konnte. Vor allem im Westen kam es zu einer Finanzkrise, und die Truppen aus germanischen Söldnern bekamen keinen Sold mehr. So kam es zum Zusammenbruch der Grenzverteidigung und die ehemaligen Söldner besetzten römisches Provinzgebiet. Ostrom, Byzanz, aber überlebte noch bis 1453, als die Türken Konstantinopel eroberten.
Buchtipp: Thomas Fischer: Gladius. Roms Legionen in Germanien. C.H.Beck, 2020, 344 Seiten, 26 Euro.
Filmtipp: Ende Oktober startete der Streaming-Dienst Netflix die sechsteilige deutsche Serie „Barbaren“. Im Zentrum steht die römische Expansion über den Rhein zur Zeit des Kaisers Augustus mit dem Höhepunkt der Varusschlacht, auch bekannt unter „Schlacht im Teutoburger Wald“. Eine Abbildung der der historischen Wirklichkeit leistet die Serie nicht, Historiker wirkten aber als Berater mit. Eine weitere Staffel ist geplant. (mic)