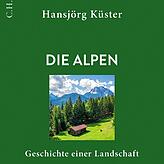Herr Küster, die Coronakrise hat den Tourismus auch in den Alpenländern stark ausgebremst. Ist das ein Fingerzeig auf eine Denkpause, zu der der Erhalt der Alpen als Naturraum zwingt?
Ich glaube, dass die Corona-Krise die Chance bringt, über die Dinge neu nachzudenken. Dazu gehört auch das, was ich „schnellen Tourismus“ nenne, der auf Verbrauch und Konsum ausgerichtet ist. Man muss über den Tellerrand des verbrauchenden Tourismus hinaussehen und das Reisen wieder mehr als Bildungserlebnis begreifen.

Aber jetzt, wo das Reisen wieder möglich ist, setzen sich die Massen erneut Richtung Alpen in Bewegung...
Der Deutsche Alpenverein hat empfohlen, die Touristenmenge zu verteilen, um sehr beliebte Orte zu entlasten. Ich glaube nicht, dass das etwas bringt. Aber wir müssen die touristischen Brennpunkte der Alpen besser vermitteln. Das heißt: Man muss die Touristen dort, wo die ankommen – etwa auf Parkplätzen und in Parkhäusern – umfassend darüber informieren, was sie an Natur und Kultur erwartet. Beispielhaft ist da etwa der Schweizer Glacier-Express, mit dem man zwischen Zermatt und St. Moritz eine wunderbare Bildungsfahrt durch die Alpenlandschaft machen kann.
Das heißt: Öffentliche Verkehrsmittel haben Vorfahrt vor Individualverkehr?
Ja, so sollte es sein. Dazu müssten die Gemeinden Pläne entwickeln, um den Touristenstrom zu bündeln und Angebote zu machen – etwa für Busse, Bergbahnen oder Seilbahnen.
In Österreich sollen Skigebiete – etwa zwischen Innsbruck und Ischgl – miteinander verbunden werden, wobei auch an Sprengungen gedacht ist. Kommt der Landschaftsschutz unter die Räder oder vertrauen Sie den Behörden?
Da vertraue ich den Planern und Behörden eher nicht. Das Problem ist ja, dass viele Besucher an Weihnachten Ski fahren wollen und künstliche Pisten angelegt werden, obwohl noch gar kein Schnee liegt. Das aber gefährdet die Almwirtschaft. Die für den Skitourismus notwendigen Anlagen – wie etwa Wasserbecken für die Versorgung der Schneekanonen – müssen so angelegt werden, dass sie die Almnutzung und den ästhetischen Eindruck der Hochlagenlandschaft nicht zu stark beeinträchtigen.
Das hört sich nach Interessenkonflikten an...
Man muss die Interessen klug zusammenbringen. Denn wenn die Almwirtschaft eingestellt wird, wachsen sie Hänge zu und man kann dort nicht mehr Ski fahren. Die Notwendigkeit für riesige Skigebiete sehe ich nicht. Die Alpen sind groß genug und bieten genügend Ski-Regionen, um allen sportlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Um die Alpen ranken sich viele Legenden und falsche Mythen. Das betrifft auch angeblich traditionelle Kleidung:
In Tirol macht man Landstraßen für den Transitverkehr dicht, und für Motorräder werden Strecken gesperrt. Ist für die Einheimischen nach 100 Jahren Tourismus eine Schmerzgrenze erreicht?
In Tirol gibt es nicht gerade viele Straßen für den Fernverkehr und daher bündelt sich dort der Verkehr. Daher müssen wir uns überlegen: Welche Fahrten sind notwendig? Und wie kann man aus ihnen eine Bildungsreise machen? Das ist ja kein Problem, das auf Tirol begrenzt ist.
Motorradfahrer sollten sich überlegen, ob es damit getan ist, sich nur in die Kurve zu legen und Lärm zu machen. Oder kann man nicht auch mit dem Motorrad ein Bildungserlebnis erreichen? Das Nachdenken betrifft aber die ganze Gesellschaft, nicht nur die Motorradfahrer.
Sie haben der Schweiz in Ihrem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet. Warum? Weil es die Schweiz ohne die Alpen nicht gäbe?
Das Interessante am Phänomen Schweiz ist, dass sie sich von ihren Nachbarn früh politisch abgehoben hat. Das würde auch mit dem Freiheitsgefühl begründet. Nicht umsonst spielt der Gründungsmythos auf einer Alm, nämlich der Rütli-Wiese. Aber die Schweiz war auch in der Naturforschung, die schon im 17. Jahrhundert einsetzte, führend. Wenn wir heute auf der ganzen Welt vom „alpinen Hochgebirge“ sprechen, hat daran die Schweiz und vor allem das liberale forschungsorientierte Zürich einen großen Anteil.
Stichwort: Die Alpen im Schulunterricht. Sollte man das Thema im Sinne einer ökologischen Bildung von Kindern und Jugendlichen stärken? Und was könnte man sich vorstellen?
Dafür muss man zunächst mal wieder ein Bewusstsein schaffen. Solche bewährten regionalen Ansätze wurden als „Briefträger-Geografie“ geschmäht und dann hat man die Landeskunde zu einem Großteil vom Lehrplan gekippt. Das ist eine verheerende Entwicklung an den Schulen! Man könnte mit Blick auf die Alpen mit Schülern eine Menge machen. Etwa auf einen Berg wandern. Da muss man als Lehrer gar nicht mal so viel erklären, sondern man lässt die Eindrücke bei den Schülern wirken.
Bester Anschauungsunterricht also?
Nun, es ist natürlich schön, wenn Schüler die wichtigsten Pflanzen der Alpen kennen und ein Murmeltier von einem Steinbock und eine Krähe von einem Adler unterscheiden können. Erklärt werden sollte auch, wie die Almwirtschaft funktioniert und was auf einer Alm produziert wird – Milch und Käse etwa. Betrachten kann man die unterschiedlichen Vegetationszonen.
Man kann innerhalb eines Tagesausflugs sehr viel sehen- zum Beispiel um den Säntis im Appenzeller Land oder am Vierwaldstätter See. Da warten auf die Schüler tolle Erlebnisse! Ich selbst bin durch einen Urlaub in den Alpen als junger Mann von den Orchideen dort so fasziniert worden, dass mich das inspiriert hat, Botaniker zu werden.
Lesetipp: Das Buch von Hansjörg Küster, „Die Alpen. Geschichte einer Landschaft“, ist kürzlich im Beck-Verlag in der bekannten Reihe „Wissen“ erschienen; es hat 128 Seiten und kostet 9,95 Euro.