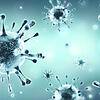Das RKI hat die notwendige Impfquote ermittelt, um Covid-19 unter Kontrolle zu bringen. Demnach wäre eine Impfquote von 85 bis 90 Prozent nötig. Das läge über dem Wert der ursprünglich angenommenen Werte für die Herdenimmunität. Ist das überhaupt erreichbar?
Das Konzept der Herdenimmunität bedeutet ja, dass keine Viruszirkulation mehr auftritt und auch diejenigen geschützt werden, die keine Immunität besitzen. Zu berechnen, ab wann das Virus nicht mehr zirkulieren kann, funktioniert für manche Erreger sehr gut, etwa bei den Masern. Bei anderen Viren ist das deutlich schwieriger.
Bei Corona lässt sich kein genauer Wert berechnen, sondern lediglich eine mathematische Modellierung mit verschiedenen Annahmen durchführen. Das ist keine Prognose, sondern gibt Aufschluss über die Parameter, auf die es besonders ankommen wird. Beispielsweise wissen wir noch nicht, wie lange die Immunität bei den verschiedenen Impfstoffen jeweils anhält. Es gibt auch Unsicherheiten bei der weiteren Entwicklung der Virusvarianten und wie gut sie von den Impfstoffen abgedeckt werden.

Noch einmal die Frage: Ist eine Impfquote von 85 Prozent oder mehr bei den 12-bis-59-Jährigen überhaupt möglich?
Das ist ein sehr ambitionierter Wert, der für diese große Altersgruppe bisher noch nicht in Sicht ist. Ob wir in unserer freien, pluralistischen Gesellschaft eine so hohe Quote erreichen, muss sich noch zeigen. Ich hoffe sehr, dass wir das schaffen und damit beweisen, dass gerade auch liberale, aufgeklärte Gesellschaften eine kollektive Strategie- und Handlungsfähigkeit besitzen.
Die genannte Altersgruppe ist deswegen so wichtig, weil wir bislang noch keine Möglichkeit haben, kleinere Kinder zu impfen und noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Kinder über 12 Jahren besteht. Daher ist das 85-Prozent-Ziel keines, das wir für alle Altersgruppen in naher Zukunft realistisch erreichen werden.
Bei Menschen über 60 Jahren ist laut RKI eine Impfquote von 90 Prozent möglich. Schon jetzt sollen demnach 85 Prozent der über 60-Jährigen mindestens ein Mal geimpft sein. Halten Sie das für erreichbar?
Ja, es könnte durchaus sein, dass das bei den über 60-Jährigen klappt. Denn wer über 60 Jahre alt ist, gehört zu den Menschen, die ein deutlich höheres Risiko haben. Wer sich da nicht impfen lässt, spielt mit seiner Gesundheit.
Wie gefährlich ist die Deltavariante wirklich?
Sie hat ein höheres Übertragungspotenzial als die bislang vorherrschende britische Variante. Die Deltavariante wird sich daher weiter ausbreiten und der dominante Virustyp werden. Das ist keine gute Nachricht, weil die Deltavariante mindestens so gefährlich ist, wenn nicht gefährlicher als die Ursprungsvariante.
Dazu kommt, dass sie durch die Impfung nicht so effektiv erreicht wird wie die britische Variante. Wir sind auch deshalb in einer kritischen Entwicklung, weil es möglich ist, dass sich die neuen Virusvarianten noch weiter vom Ursprungsvirus entfernen und damit die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt.

Lässt sich die weitere Entwicklung der Virusvarianten denn ein Stück weit vorhersehen?
Coronaviren verändern sich immer in kleinen Schritten, um den Antikörpern aus dem Weg zu gehen. Was man nicht so genau weiß, ist, wann sehr deutlich veränderte neue Varianten entstehen, wie zuletzt die indische. Wir wissen deshalb nicht, wann weitere Varianten kommen, die ein noch überlegeneres Potenzial gegen Antikörper und eine höhere Übertragbarkeit haben. Es wäre verwunderlich, wenn nicht noch weitere Varianten auftreten. Welchen Schaden sie dann anrichten können, lässt sich aber nur schwer einschätzen.
Lässt sich denn inzwischen bestimmen, wie lange die Impfung wirkt?
Nein, das lässt sich noch nicht genau festlegen. Die Pandemie und die verschiedenen Impfstoffe gibt es ja noch gar nicht so lange. In einem Jahr wird man das genauer sagen können.
Wovon hängt es denn ab, wie lange man immun ist?
Dazu muss man das immunologische Gedächtnis verstehen. Es besteht aus drei Teilen: den Antikörpern, den Gedächtnis-B-Zellen, die die Antikörper produzieren und den T-Lymphozyten. Antikörper können nach der Impfung innerhalb einiger Monate wieder abnehmen, dagegen bleiben die Gedächtnis B- und T-Zellen aber deutlich länger erhalten. Der so vermittelte Schutz kann durchaus längere Zeit anhalten, vor allem gegen eine schwerere Erkrankung, aber weniger gegen eine leichte Infektion. Man muss also zwischen Infektion und Krankheit deutlich unterscheiden.

Die Deltavariante wurde ja schon bei Geimpften festgestellt, es kam sogar zu Todesfällen.
Das stimmt. Der Blick auf Israel und Großbritannien zeigt, dass sich selbst bei einer relativ guten Impfsituation die Deltavariante ausbreiten kann. Von Impfdurchbrüchen Betroffene haben in aller Regel nur leichte Infektionen, können aber zur Ausbreitung des Virus beitragen. Die bisherigen Varianten werden von den heutigen Impfstoffen also durchaus erreicht und bieten zumindest Schutz vor einem schweren Verlauf und Tod. Aber klar ist: Wir werden zukünftig an die neuen Varianten angepasste Impfstoffe brauchen.
Wiegen wir uns mit den Covid-Zertifikaten damit in falscher Sicherheit?
Ein Zertifikat über ein Jahr ist sicher keine Garantie, dass man auf keinen Fall in diesem Zeitraum eine Infektion bekommt. Die volle Impfung ist aber ein Schutz vor schwerer Erkrankung. Selbst wenn man sich infiziert, ist der Verlauf abgeschwächt, und es entstehen auch weniger neue Viren, die man weitergeben kann.
Rechnen Sie mit einer vierten Welle im Herbst?
Das hängt davon ab, was man darunter versteht. Blickt man nur auf die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen, dann ja, wir werden eine vierte Welle sehen. Sie beginnt schon jetzt und wird sich langsam aufbauen, wie das im vergangenen Jahr auch der Fall war.

Wird die Welle anders als die bisherigen verlaufen mit Blick auf Krankenhauseinlieferungen und Todeszahlen?
Ja. Es wird deutlich weniger Todesfälle geben, weil viele Menschen der Risikogruppen geimpft sind. Auch die Intensivstationen werden weniger ausgelastet sein. Da die jungen Menschen noch nicht geimpft sind, wird sich die vierte Welle sicher auch in den Schulen abspielen. Darauf sollten uns einstellen. Wir sollten dann keine unnötige Panik entwickeln, aber genau hinschauen. Damit die Schulen offen bleiben können, sollten wir dort regelmäßig testen.
Die Schnelltests, die in den Schulen eingesetzt werden, sind ja nicht sehr zuverlässig… Sind sie überhaupt noch das richtige Mittel gegen die Pandemie?
Es gibt ja inzwischen auch Pool-PCR-Test-Konzepte, wie sie hier in Freiburg entwickelt werden. Die sind Schnelltests sicher überlegen, weil sie zuverlässiger und empfindlicher sind. Falls man das nicht überall verwirklichen kann, führt kein Weg an den Schnelltests vorbei. Hier muss die Politik aber endlich aktiv werden, um sicherzustellen, dass die Schnelltests in verlässlicher Qualität hergestellt werden. Bisher gibt es weder unabhängige Qualitäts- noch Chargenkontrollen. Diese Lücke sollte geschlossen werden.
Das ist, ehrlich gesagt, ein unsäglicher Zustand, dass wir die Tests schon so lange haben, aber keine qualitätsgesteuerten Zulassungsverfahren oder Ringversuche. Die Hersteller können sich selbst Zeugnisse über die Zuverlässigkeit der Tests ausstellen, von denen jeder weiß, dass sie in der Praxis nicht stimmen. So etwas gibt es in keinem anderen medizinischen Bereich.
Was für Corona-Maßnahmen sind mit steigender Impfquote überhaupt noch sinnvoll? Oder können wir die Maßnahmen ganz fallen lassen?
Nein. Die brauchen wir weiterhin. Wir wollen die Inzidenz ja niedrig halten, um die Zahl schwerer Verläufe möglichst gering zu halten. Es wird weiterhin Menschen geben, die nicht geschützt sind. Zum Beispiel Menschen nach einer Organtransplantation, die Immunsuppressiva nehmen müssen. Wir werden deshalb Testkonzepte in den Schulen und bei Veranstaltungen brauchen und weiterhin in geschlossenen Räumen Maske tragen müssen.
Aber die Situation ist viel besser als noch vor einem Jahr, als wir noch keine Impfung hatten und sich das Virus noch ungebremst ausbreiten konnte. Schlussendlich kommen wir so langsam aber erfolgreich aus der Pandemie heraus. Das ist doch keine schlechte Nachricht.
Welche Impfquote wir brauchen, um die Pandemie einzudämmen
Das Robert-Koch-Institut hat einen Zielwert für die nötige Impfquote berechnet, mit der sich die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle bringen lässt.
Dazu hat das Institut verschiedene Modellszenarien zugrunde gelegt und dabei den Einfluss verschiedener Impfquoten auf die Zahl der Neuinfektionen und Intensivbettenbelegung bis zum kommenden Frühjahr simuliert. Das Institut weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um exakte Prognosen handele, sondern „eine Abschätzung des Einflusses der Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen“.
Bei der Altersgruppe der 12- bis 59-Jährigen wurde mit Impfquoten von 65, 75, 85 und 95 Prozent variiert, bei der Altersgruppe über 60 Jahren legte das RKI 90 Prozent zugrunde, da bereits jetzt 85 Prozent der über 60-Jährigen eine Erstimpfung hätten.
Durchgespielt werden Szenarien wie keine Verhaltensänderung trotz steigender Intensivbettenauslastung, eine Rückkehr zu dem Verhalten vor der Pandemie, eine erhöhte Impfbereitschaft der über 60-Jährigen, eine geringere Impfkapazität pro Tag.
Das Institut kommt dabei zu dem Schluss, dass eine „Zielimpfquote von 85 Prozent für die 12– 59-Jährigen sowie von 90 Prozent für Personen ab dem Alter von 60 Jahren“ notwendig und auch erreichbar sei. Sollte die Quote „rechtzeitig“ erreicht werden, sei eine 4. Welle im Herbst oder Winter „unwahrscheinlich“, sofern neben der Impfung weiter die Hygienemaßnahmen eingehalten und „bei möglicherweise wieder ansteigenden Infektionszahlen Kontakte zu einem gewissen Grad reduziert“ würden.