Gleich fünf Themen standen an diesem Sonntag in der Schweiz zur Abstimmung: Die Eidgenossen entschieden über die Qualität des Trinkwassers, das Verbot von Pestiziden, die drastische Senkung von CO2-Emissionen sowie ein umstrittenes Antiterrorgesetz. Zudem sollten die Eidgenossen über das bereits in Kraft getretene Covid-19-Gesetz abstimmen. Die Hochrechnungen zeigen ein klares Bild. Die Schweizer sind gegen stärkeren Umweltschutz, aber für schärfere Gesetze in Sachen Antiterror. Die Covid-19-Politik der Regierung unterstützen sie ebenfalls.
Kein Pestizid-Verbot
Alle drei Umwelt-Vorlagen scheiterten, die CO2-Senkung mit 51,6 Prozent eher knapp. Die Trinkwasser-Initiative (60,7 Prozent dagegen) sah vor, Bauern, die künstliche Pestizide einsetzen, die Subventionen zu streichen. Derzeit erhalten Schweizer Bauern umgerechnet circa 2,6 Milliarden Euro jährliche Direktzahlungen vom Staat. Ein Ja zur Trinkwasser-Initiative hätte dazu geführt, dass Bauern, die weiter Gelder vom Staat bekommen wollen, vollkommen auf Pestizide sowie auf Antibiotika in der Viehzucht verzichten müssen. Zudem hätten nach der neuen Regelung nur noch so viele Tiere gehalten werden dürfen, für die ein Betrieb selbst ausreichend Futter produzieren kann.
Dies lehnten die Schweizer ebenso ab wie das Verbot von Pestiziden (60,6 Prozent dagegen), das die Schweiz zum zweiten Bio-Land weltweit gemacht hätte. Mit der Änderung wäre auch die Einfuhr von mit Pestiziden behandelten Lebensmitteln nicht mehr erlaubt gewesen. Auch für deutsche Konsumenten wären Schweizer Produkte voraussichtlich teurer geworden, da Bioproduktion meist weniger Ertrag abwirft, die Produktionskosten aber höher liegen als bei konventionellem Anbau.
Die drastische Senkung der CO2-Emissionen bis 2030 auf das Niveau von 1990 hätte starke verkehrspolitische Konsequenzen für das Land gehabt. So sah das Gesetz unter anderem eine Abgabe auf Flugtickets von 30 bis 120 Franken vor, je nach Distanz. Benzin- und Diesel wären teurer geworden. Auch die Grenzwerte beim CO2-Ausstoß von Neuwagen oder bei Gebäuden sollten gesenkt werden. Kritiker fürchteten deutliche Mehrkosten für Privathaushalte von bis zu 1000 Franken. Befürworter sahen eine Chance für die heimische Wirtschaft – bislang fließen über acht Milliarden Franken pro Jahr in fossile Energieträger aus dem Ausland.
Covid-19-Gesetz gilt weiter
Zustimmung fand dagegen das Covid-19-Gesetz (60,2 Prozent dafür), das unter anderem Finanzhilfen für Unternehmen, Medien, Sport und Kultur ermöglicht. Die Initiatoren des Referendums, die sogenannten „Verfassungsfreunde“, hatten moniert, dass das Gesetz dem Staat die „totale Macht“ verleihe. Die meisten Bestimmungen sind allerdings ohnehin zeitlich befristet und laufen zum Jahresende aus.
Ursprünglich ging es dabei um Kurzarbeit, das Verbot planbarer Eingriffe in Spitälern, um Kapazitäten frei zu halten für Covid-Patienten, oder die vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln, um schnell Behandlungsmethoden gegen die Krankheit zu entwickeln. Später kamen Finanzhilfen für Unternehmen, Medien, Kultur und Sport hinzu sowie die Möglichkeit für Kurzarbeit.
Schärferes Antiterrorgesetz wird kommen
Ebenso stimmten die Eidgenossen für das von Menschenrechtsorganisationen scharf kritisierte Antiterrorgesetz PMT (56,6 Prozent dafür), das präventive Maßnahmen bis hin zu Hausarrest für Minderjährige ermöglicht.
In der Schweiz kam es im vergangenen Jahr zu zwei möglicherweise terroristisch motivierten Anschlägen, die Bundespolizei geht von etwa 30 Gefährdern schweizweit aus. Das Gesetz ist bereits verabschiedet, eine linke Bewegung hat jedoch ein Referendum dazu erzwungen, mit Unterstützung der „Verfassungsfreunde“.
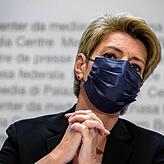
Menschenrechtsorganisationen kritisieren die unscharfe Definition von „terroristisch“, die Interpretationsspielraum zulasse. So sind nach dem neuen Gesetz bereits „Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder Androhung von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken“ als terroristisch einstufbar – und damit präventive Maßnahmen möglich.
Außerdem seien die Maßnahmen für Betroffene vor Gericht kaum anfechtbar, weil dafür bloße „Anhaltspunkte“ ausreichten. Dies fördere Tür und Tor für Willkür, moniert etwa Amnesty International.
Die Stimmbeteiligung lag Hochrechnungen zufolge mit 59 Prozent so hoch wie selten. Eine so hohe Beteiligung an den Abstimmungen erreichen sonst nur Referenden oder Volksentscheide, bei denen es um außenpolitische Themen geht.









