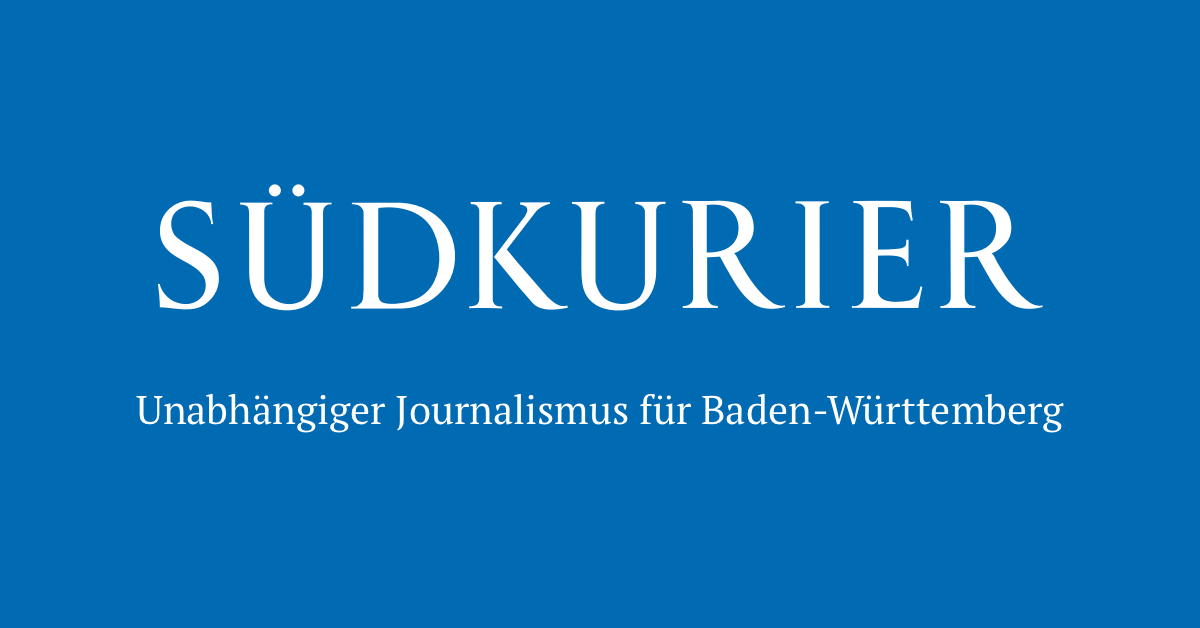Die Corona-Pandemie bringt den Luftverkehr weltweit in Turbulenzen. Auch der Flughafen Zürich gerät dabei unter Druck. Nachdem das Passagieraufkommen nach dem verheerenden Corona-Frühjahr im Sommer wieder etwas angestiegen war, erwischt es das Drehkreuz im Oktober erneut heftig. Ein Minus von 84 Prozent verzeichnet der Airport bei den Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresmonat, entsprechend ging auch die Zahl der Flugbewegungen um 65 Prozent zurück. Das macht sich auch am Himmel über der Region bemerkbar, zumal auch ein Drittel weniger Frachtflüge unterwegs sind.

Damit scheint der sogenannte Fluglärmstreit zwischen Deutschland und der Schweiz zunächst einmal ausgesetzt zu sein. In den guten Jahren des Flughafens flogen über 100.000 Maschinen auf Seite deutscher jährlich über die Köpfe der Menschen.
Mit dem Ausbau der Rollwege auf dem Airport und mit dem geplanten neuen Betriebsreglement erwarten Kritiker noch eine weitere Zunahme des Flugverkehrs. Doch davon scheint man derzeit weit entfernt zu sein. Deutlich seltener setzen über Hohentengen und Lauchringen Passagiermaschinen zur Landung an, auch am Bodensee und über dem Schwarzwald hat der Flugverkehr in Corona-Zeiten ein Niveau erreicht, das man vor der Jahrtausendwende kannte.

Doch das dürfte sich nach Corona wieder ändern. So rechnet man auf beiden Seiten mit einer Rückkehr des Flughafens zur alten Stärke. In einer Pressemitteilung gibt sich die Flughafen Zürich AG optimistisch, dass man stark genug ist, „um innerhalb der kommenden Jahre wieder auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren“.
Was macht der Staatsvertrag?
Vor acht Jahren wurde unter dem damaligen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) ein Staatsvertrag ausgehandelt, der zwar in der Schweiz gebilligt, aber nie dem Deutschen Bundestag zur Ratifizierung vorgelegt wurde. Gerade in der Region Südbaden gab es heftigen Widerstand gegen das Papier, das aus Sicht seiner Kritiker eine deutliche Mehrbelastung der deutschen Seite bringen würde.
Während die Schweiz in allen Gesprächen auf diesen Vertrag als Grundlage pocht, gilt er auf deutscher Seite als „tot“, wie es ein Abgeordneter formulierte. Das Problem um den Flugverkehr wurde an die Landesregierung beziehungsweise an die betroffenen Landkreise weitergereicht. Dort, so der Plan, soll eine Mediation den Streit aus dem Weg schaffen.
Was macht eigentlich die Mediation durch Ex-General Wolfgang Schneiderhan?
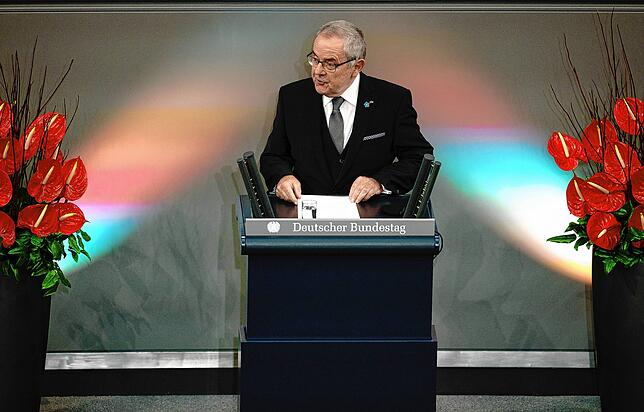
Noch zum Jahresbeginn hatten CDU-Abgeordnete aus der Region gemeinsam mit dem Kreis Waldshut auf eine solche Mediation gesetzt, für die man den ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhan gewinnen konnte. Er führte nach eigenen Angaben bereits 2019 im Hintergrund Gespräche und sollte eigentlich helfen, „eine langfristige Lösung des Fluglärmstreits“ zu erarbeiten, wie der Lauchringer CDU-Abgeordnete Felix Schreiner damals erklärte. „Am Ende dieses Verhandlungsprozesses könnte ein neuer Staatsvertrag stehen“, äußerte er sich vorsichtig optimistisch.
Doch eine für den 1. April angesetzte Veranstaltung am Hochrhein wurde wegen der Pandemie abgesagt. Und in der Schweiz übte man Zurückhaltung gegenüber einer Mediation, mit Verweis auf den in Deutschland nicht ratifizierten Staatsvertrag.
Daran hat sich offenbar nichts geändert. So erklärt Schreiner jetzt gegenüber dem SÜDKURIER, es werde nach einem neuen Termin für das Frühjahr 2021 gesucht. Angesichts der Corona-Pandemie sei davon auszugehen, dass die Veranstaltung dann in größerem Rahmen auch mit den Landräten über eine Video-Schalte stattfinden wird. Auch für Bürger solle diese dann offen sein. Und Susanna Heim, Sprecherin des Waldshuter Landrats, erklärt: „Der Ball liegt jetzt in der Schweiz, die entscheiden muss, ob sie sich auf den Mediationsprozess einlassen möchte.“
Verfahrensprüfung durch die Vereinten Nationen (Unece) in Genf
Unangenehm könnte indessen noch ein Vorgang auf diplomatischer Ebene werden. Derzeit befasst sich ein Kontrollausschuss der UN-Organisation Unece in Genf mit der Frage, ob die Expansionspläne Zürichs gegen internationales Recht verstoßen.
Seit Monaten befasst sich der Ausschuss mit der Einhaltung der sogenannten Espoo-Konvention, die sowohl Deutschland wie die Schweiz unterschrieben haben. Demnach verpflichten sich beide Staaten bei Großprojekten wie dem Flughafenausbau zur Transparenz anhand einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung (gUVP). Über die Ergebnisse ihrer Sitzungen, die zur Zeit wegen Corona per Video stattfinden, informiert der Ausschuss auf seiner Internetseite.
Demnach schält sich heraus, dass die Bundesregierung den umfangreichen Ausbau des Pistensystems auf dem Zürcher Flughafen und das geplante Betriebsreglement als problematisch ansieht, die Landesregierung hingegen beides aus unklaren Gründen zulassen will. In ihrem jüngsten Schreiben stellt der Ausschuss fest, dass sich aus Sicht Berlins beide Maßnahmen „zu einem Gesamtprojekt summieren und erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in Deutschland haben“.
Die Schweiz wird nun aufgefordert, diese Gesamtauswirkungen darzulegen, nachdem Bern dies bislang abgelehnt hat. Die Schweizer Dokumente sollen bis zum 12. Januar vorliegen, damit der Ausschuss sie bei seiner nächsten Tagung Anfang Februar 2021 prüfen kann.

Als Problem könnte die Einflugschneise über dem badischen Hohentengen in den Fokus rücken. Dort nämlich sind zwei von drei möglichen Standorten für das Schweizer Atomendlager vorgesehen. Am Eingang einer solchen Einrichtung befindet sich die sogenannte Heiße Zelle, in der der Atommüll aus dem Castor-Transportbehälter in einen Endlagerbehälter umgefüllt wird. Kritiker wie die Bürgerinitiative gegen Flugverkehrsbelastung am Hochrhein sehen ein massives Risiko im Falle eines Flugzeugabsturzes auf die Heiße Zelle.
Landesregierung will keine grenzüberschreitende Prüfung
In der Landesregierung herrscht bei diesem Punkt allerdings ein beredtes Schweigen. So hatte noch die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer von der Schweizer Seite eine grenzüberschreitende UVP angemahnt, die sich auch mit dem Schwachpunkt der Einflugschneise beschäftigen müsste.
Doch in Stuttgart tritt man auf die Bremse. „Die Espoo-Konvention stellt für einen solchen Fall ein sehr zeitaufwändiges völkerrechtliches Verfahren zur Streitbeilegung bereit, das auf deutscher Seite von der Bundesregierung beantragt werden müsste“, heißt es in einer Stellungnahme des Verkersministeriums gegenüber dem SÜDKURIER. Die Schweiz habe sich auf entsprechende Forderungen allerdings nie eingelassen. Das Ministerium räumt ein: „Auf deutscher Seite gab es unterschiedliche Auffassungen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für ein solches Verfahren vorliegen.“ Der Ball liege aber in der Region.
„Das Verkehrsministerium ist offen für ein derartiges Verfahren, wenn es regional gewünscht wird“, lautet die Antwort aus dem Ministerium. Allerdings sei man äußerst skeptisch: „Zur zeitnahen Reduzierung des Fluglärms auf deutscher Seite wird dieses Verfahren jedoch eher nicht führen.“