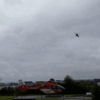Schon 1969, da war er noch Assistenzarzt in Villingen-Schwenningen, sah Udo Stirner Handlungsbedarf. Rettungssanitäter brachten schwerstverletzte Unfallopfer in die Klinik, oft kam jede Hilfe zu spät. Doch Ärzte durften damals das Krankenhaus nicht verlassen, nicht auf die Straße gehen, um vor Ort Patienten zu versorgen. Stirner engagierte sich und baute den ersten Rettungsdienst auf.
Als er 1975 die Stelle als Oberarzt in der Kardiologie am „Städtischen Krankenhaus Friedrichshafen“ antrat, hielt ihn nichts davon ab, auch hier, unbezahlt und neben seiner regulären Tätigkeit, als Notarzt zu arbeiten. Und er wurde zum zweiten Mal zum ärztlichen Geburtshelfer eines Rettungsdienstes.

Ein Helikopter musste her
Bis 1980 war Stirner am Boden im Einsatz. Die Autounfälle auf der B 31 häuften sich mit zunehmendem Verkehr und für viele der Opfer war der Weg im Rettungswagen nach Ulm oder Tübingen zu weit. Zwei Stunden, die das Zeug dazu hatten, über Leben und Tod zu entscheiden. Ein Helikopter musste her.
Martin Herzog, damals Oberbürgermeister der Stadt, und Jürgen Flemming, als erster Bürgermeister zuständig für die Belange des Krankenhauses, unterstützten Stirner bei seinem Vorhaben, einen Rettungshubschrauber zu stationieren. Den Auftrag bekam die DRF Luftrettung – damals noch „Deutsche Rettungsflugwacht“ genannt – die seit 1973 im Einsatz war, die zuständige Rettungsleitstelle betrieb das Deutsche Rote Kreuz.
„Christoph 45“ bekam einen Suchscheinwerfer
Als Standort kam damals Ravensburg ins Spiel. Doch weder das Engagement noch der Landeplatz konnten überzeugen. Letzterer lag zu weit vom Elisabethenkrankenhaus entfernt, Patienten hätten vom Hubschrauber in den Rettungswagen umgelagert werden müssen. Direkt am See, so glaubte man, fehlte eine Dimension und damit eine ausreichende Zahl an Notfällen. Doch weit gefehlt. Schon damals galt es, eine im Wasser treibende Person rechtzeitig zu lokalisieren, um sie vor dem Ertrinken zu retten. Da kam es auf jede Minute an. Das Klinikum machte sich für den Standort Friedrichshafen stark.
Schon im Oktober 1980 stationierte die DRF Luftrettung einen Hubschrauber des Typs Bell 206, zunächst einmal provisorisch.
Rolf Duda, ehemaliger Bundeswehrpilot mit Erfahrung im Search-and-Rescue-Einsatz, war Pilot der ersten Stunde in Friedrichshafen und erinnert sich gut an einen tragischen Seenotfall bei dem 1981 zwei Jugendliche ertranken. Erst im frühsten Morgenlicht konnte er den See absuchen und sah einen dritten Schiffbrüchigen in der Seemitte schwimmen. Er setzte sich dafür ein, dass der Hubschrauber mit einem Suchscheinwerfer ausgerüstet wurde, um auch nachts solche Einsätze zu fliegen.

Technische Schwierigkeiten und fehlende Akzeptanz
Schon drei Jahre später wurde der erste Hubschrauber durch einen des Typs BO 105 ersetzt. Auch Udo Stirner erinnert sich: Im Deggenhausertal war eine Frau unter einen Traktor geraten, höchste Eile war angesagt. Zügig wurde sie versorgt und in den Hubschrauber gebracht. Doch mehr als einen Meter brachte der Pilot den Hubi nicht in die Luft. Das Gesamtgewicht mit der beleibten Patientin überstieg das Startgewicht seines Flugkörpers und der Transport musste über den Landweg abgewickelt werden.
Zu solchen technischen Anfangsschwierigkeiten gesellte sich auch fehlende Akzeptanz mancher Ärzte und die Leitstelle forderte den Hubschrauber nur wenig an. Höchstens 500 bis 600 Einsätze im Jahr, sagt Rolf Duda, seien es anfänglich gewesen. Ein niedergelassener Arzt versuchte faustschwingend, die Landung des als „Patientenstaubsauger“ verschrienen Hubschraubers an einem Unfallort mit mehreren Schwerstverletzten zu verhindern. So sehr fühlte sich der Arzt in seiner Kompetenz infrage gestellt. Und der Chefarzt eines benachbarten Krankenhauses fuhr mit seinen Mercedes so lange Kringel auf dem Landeplatz, bis die Patientenanlieferung abgeblasen werden musste. Doch mit der Zeit glätteten sich die Wogen.

1987 legte man sich auf Friedrichshafen fest
Jeden Abend vor Sonnenuntergang musste Duda oder einer seiner Kollegen „Christoph 45“ in sein Nachtquartier fliegen. Ein Gabelstapler schob ihn auf seiner Landeplattform in eine Halle der Firma Dornier am Flughafen. Dort wurde er auch betankt. Morgens um 6.30 Uhr flog ihn der heute 78-Jährige wieder zurück zum Krankenhaus.
Erst 1987 legten sich das Sozialministerium Baden-Württemberg, der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und das Regierungspräsidium Tübingen endgültig auf den Standort Friedrichshafen fest. Neue Büro- und Sozialräume sowie ein neuer Hangar wurden gebaut, ein Jahr nach dem Einzug – das war 1995 – kam sogar eine eigene Tankstelle dazu. Alles war perfekt. Nur 2007 musste der Landeplatz aufgrund einer EU-Richtlinie etwas weiter Richtung See verlegt werden.
Seit 2018 ist ein Airbus-Helikopter Typ H135 im Einsatz. Mit 260 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit bringt er Notarzt und Notfallsanitäter in fünf Minuten nach Ravensburg oder in 15 Minuten in Skigebiete, um Patienten und Lawinenopfer ins Krankenhaus zu bringen. Rolf Duda sagt: „Wir sind auch bei Hochnebel geflogen.“ Immer am Ufer entlang bis Lindau, das sie meist mit strahlendem Sonnenschein empfing. Von dort aus ging‘s problemlos ins Gebirge.