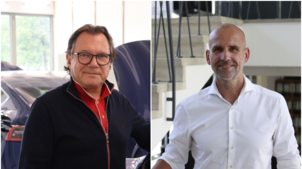Ein diffuser Akkord klingt in der Überlinger Auferstehungskirche. Gleichförmig und rätselhaft wie eine nebelverhangene Wasseroberfläche klingt er im Saal. Dann bricht Licht durch den Dunst. Eine Melodie schiebt sich durch den dumpfen Hall wie vereinzelte Sonnenstrahlen, die auf dem Wasser glitzern. Organistin Stefanie Jürgens spielt das Hauptthema aus dem Film „Cinema Paradiso“ von Ennio Morricone. In der Kirche probt sie Film- und Popmusik. Sie will ungewöhnliche Stücke auf der Orgel spielen, zeigen, das Instrument ist nicht auf die Begleitung sakraler Hymnen reserviert. Ihre Biografie zeigt: Die Musikerin braucht die Freiheit, wie die Orgel die Luft zum Klingen.

Musik hält die Angst in Schach
„Was man nicht ausdrücken kann, kann man mit der Musik fühlen“, sagt Jürgens im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Heute sei Musik umso wichtiger, findet sie, sie könne Angst nehmen. „Es gibt viel diffuse Angst davor, was passiert in Österreich, was in den USA, was vor den nächsten Wahlen“ – ein Konzert öffne die Seele für die Musik. Das halte die Angst in Schach. Nur ihre eigene Angst wird dadurch nicht gebändigt: das Lampenfieber
Die Furcht vor dem Rampenlicht
Vor dem Musikstudium wollte sie Lehrerin werden, studierte Anglistik und Germanistik auf Lehramt. Nur es war nichts für sie, die Aufmerksamkeit, sie allein vor der Klasse. „Ich war immer total aufgeregt“, erzählt Jürgens. „Alles zittert, es ist wie Schüttelfrost – ich habe keine Kontrolle über meinen Körper“, beschreibt sie ihre Beklemmung. Sie wechselte das Studienfach und den Wohnort und widmete sich der Orgel in Heidelberg – doch die Aufregung blieb. Ihr Horrorfach: Chorleitung. Wieder stand sie allein vor einer Gruppe. Sogar vor Vorspielen habe sie sich gedrückt, habe sich krankgemeldet, um nicht im Rampenlicht zu stehen. Bis heute begleitet sie deshalb lieber oder spielt mit anderen. Sie spürt die Blicke der Leute im Rücken. „Im Ensemble wird diese Energie auf mehrere Schultern verteilt.“

Doch all die Furcht lässt sich kaum erahnen, wenn sie musiziert oder über ihre Instrumente spricht. Ihre Stimme lebt von der Euphorie für ihr Handwerk, für die Musik. Als wäre es ein Kreislauf, scheint die Musik, sie zu beleben, während sie die Noten atmen lässt. „Man muss innerlich mitsingen, dann spielt man gesanglicher und belebt die Musik – außerdem verliert man nicht das Tempo.“
Bedeutende Wurzeln
Ihre Eltern haben Jürgens musikalische Ausbildung unterstützt. Auch ihren Glauben in die Musik und Gott haben sie geprägt. „Ihnen war es wichtig, dass ich einen Beruf erlerne, der mir entspricht“, sagt Jürgens. Und immerhin scheint ihr die Musik ohnehin in die Wiege gelegt. Ihre Oma hieß Bach, sagt sie. Angeblich soll sie entfernt verwandt sein mit der bedeutenden Musikfamilie um Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach, sagt sie.
Eine, die auszog, das Musizieren zu lernen
Seit ihrem siebten Lebensjahr spielt Stefanie Jürgens Klavier. Sie lernte in Marburg an der Musikschule, über Umwege kam sie an die Orgel der Elisabethkirche ihrer Heimatstadt. Ihr Weg mit dem Instrument führte sie über Heidelberg nach Detmold.

Dort lernte sie ihren Ex-Mann kennen. Sie zogen an den Bodensee. Ihr Gatte wollte umschulen, nicht mehr Banker sein, sondern als Altenpfleger arbeiten. Damit einhergehend zog sie an den See, er wollte in die Nähe der Berge, den vorgezeichneten Weg verlassen. Sie habe ihn darin unterstützt, sagt Jürgens. So nahm ihre Beziehung aus Risiko und Freiheit ihren Lauf. Als Paar kauften sie sich ein Haus. Im Jahr 2004 bezogen sie ihre eigenen vier Wände in Uhldingen-Mühlhofen. Jürgens versuchte, ihren Weg als freiberufliche Musikerin zu gehen. Sie wurde Mutter von vier Kindern. Als das erste kam, war sie 30 Jahre alt. Als das jüngste ein Jahr war, trennt sich das Paar.
Mit den Kindern auf der Orgelbank
Sie lebt am Existenzminimum, erzählt die Musikerin. Auf Honorarbasis an Musikschulen zu unterrichten, lehnt sie ab. Die Freiheit war wichtiger. Die Frage, ob alles gut geht, hängt wie ein Damoklesschwert über ihrer Freiheit. Sie hat ihren eigenen Weg, damit umzugehen. „Die eigentlich Mutigen sind die, die voller Angst weitergehen“, zitiert sie Schriftsteller Paulo Coelho. So habe sie sich oft gefühlt. „Das ist auch Teil des Glaubens – Ich weiß jetzt gerade nicht weiter, Gott mach Du mal.“ Und so erhält sie viel Unterstützung von den Menschen aus ihrem Umfeld. „Viele Engel“ helfen ihr, wie sie sagt.
Mit diesem Vertrauen in die Welt verdingt sich Jürgens mit Orgelbegleitung von Gottesdiensten und Musikunterricht. Nie hätte sie Sozialhilfe beantragt, sagt sie. Damit begäbe sie sich in eine Abhängigkeit. Ihre Einnahmen setzte sie umgehend in Lebensmittel um. Sie lebte von der Hand in den Mund, auch wenn die Kinder Unterhalt bekamen.

Zu Proben und Auftritten brachte sie ihre Kinder einfach mit. Als sie noch Babys waren, lagen sie neben ihr auf der Orgelbank. Heute spielen sie alle ein Instrument, sagt sie nicht ohne Stolz. Jeden Cent habe sie umgedreht, um ihnen eine Ausbildung an einer Musikschule zu finanzieren. Amelie spielt Horn, Julian Trompete, Antonia Klavier und Vincent Schlagzeug. Drei von Ihnen wohnen noch bei ihr. „Wir leben wie in einer WG“, schildert Jürgens. Nun musiziert sie regelmäßig mit ihren Kindern.
Eine gefestigte Position
Ihr Weg als Freiberuflerin beginnt 2011. Um Register zu ziehen, muss sie erst allerhand Hebel in Bewegung setzen. Sie spielt weiter bei Gottesdiensten und gibt Unterricht. Gemeinsam mit Thomas Rink bewirbt sie sich auf die Position des Bezirkskantors in Überlingen. Beiden kommen in die Endauswahl, doch Jürgens scheitert an der Chorleitung. Wieder ist da die Aufregung. Inzwischen ist Rink Kirchenmusikdirektor und Jürgens seine Vertretung. Sie hat ein Deputat über 60 Stunden im Jahr inne. Es ist ihre einzige feste Position.
Jetzt ist Jürgens unendlich dankbar, so viel musizieren zu können. „Es hat sich alles so gut gefügt“, sagt sie. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde und damit dem früheren Rivalen Rink ergibt sich später auch ihre Konzertreihe Organ Vibes. Sie hat sich einen Ruf aufgebaut, nun will sie die Früchte ernten: „Ich werde im Leben keinesfalls nur auf die Rente hinarbeiten. Ich will noch so viel machen.“ Und so bleibt vieles wie gehabt: das Lampenfieber, das Risiko – aber auch die Euphorie und die Freiheit.