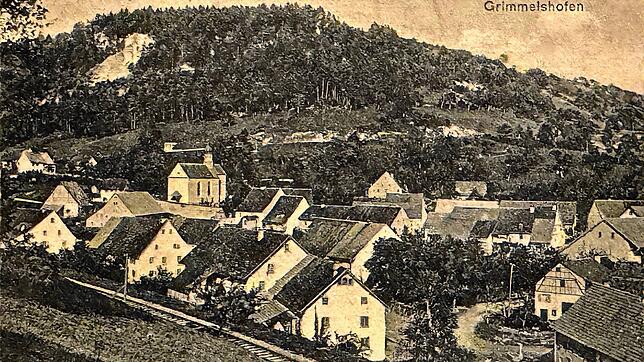Ein von Hauptlehrer Karl Ludwig Martus in Grimmelshofen im Jahr 1895 ausgefüllter Fragebogen des Großherzogtums Baden gibt Einblicke in den Alltag der Bevölkerung vor 130¦Jahren.
Nachdem im ersten Teil örtliche Begebenheiten, Namen, Nahrungsmittel und Lieder, Sprüche und Ähnliches abgehandelt wurden, sind in der heutigen Fortsetzung Auskünfte zu Sitten, Bräuchen und Sprache Thema. Aus der Fülle der Angaben können hier nur wenige wiedergegeben werden.
Gebete unter dem Kopfkissen
Zur Erleichterung der Geburt wurden den Wöchnerinnen Gebete unter das Kopfkissen gelegt und die Fenster verhängt. Die Mutter begrüßte das neugeborene Kind durch einen Kuss und die Anrufung der drei höchsten Namen (Vater, Sohn und Heiliger Geist). Die Taufe war bald nach der Geburt; der auch Gevatter oder Götti genannte Taufpate und die Gotte (Patin) gingen zum Taufschmaus in die Wirtschaft, auf Kosten des Götti. Das erste Mal das Haus verlassen durfte die Wöchnerin zur Kirche, wobei auf gutes Wetter geachtet wurde. Wenn man ihr begegnete, grüßte man mit „Viel Glück in d‘Sunn!“
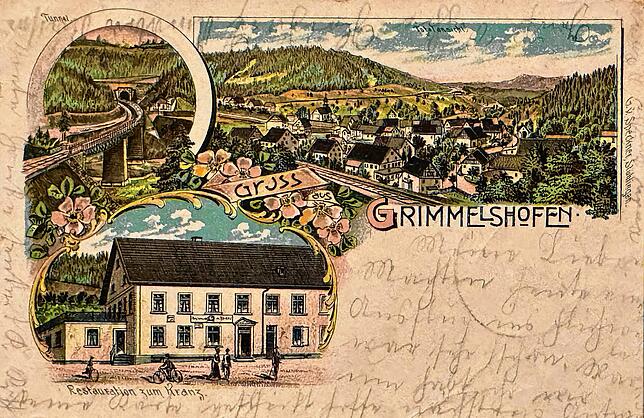
Hochzeit im schwarzen Kleid
Bei der Hochzeit war eine Beschau gebräuchlich, sofern ein Teil aus der Fremde war. Die Braut nannte man auch Brutt oder Hochziteri, den Bräutigam Hochziter. Der Brautführer hieß Gschpiel oder Ehrengeselle die Brautjungfrauen Gschpiel. Der Hochzeitslader, welcher im Namen des Brautpaars einlud, wurde von den Eingeladenen mit Getränken beschenkt. An den Verkündigungstagen, an welchen in der Kirche die Hochzeit zur Feststellung von Ehehindernissen angekündigt wurde, besuchten die Brautleute den Gottesdienst nicht, Hochzeitstage waren Dienstag oder Donnerstag. Die Braut trug gewöhnlich ein schwarzes Kaschmirkleid mit Kranz auf dem Kopf und Strauß in den Händen. Der Bräutigam trug einen schwarzen Anzug mit Zylinder und Strauß an der linken Brustseite; ebenso waren die Trauzeugen gekleidet. Das Brautabholen erfolgte durch den Paten der Braut, zur Morgensuppe waren auch der Geistliche und der Lehrer eingeladen.
War es eine Vollhochzeit, ging der Hochzeitszug, voran die Kränze (Schäppele) tragenden Mädchen und die Musik, zuerst zum Rathaus zur Ziviltrauung und von da zur Kirche. Die Braut entzündete in der Kirche einen Wachsstock und ihre Patin neben ihr eine Kerze mit drei brennenden Enden (eine Dreiangel). Der Hochzeitlader trug den unvermeidlichen Regenschirm – früher soll es ein Säbel gewesen sein. Nach der Trauung ging es zum Wirtshaus, wo die Schäppel tragenden kleinen Mädchen mit Wein und Wecken bewirtet wurden. Auch das Hochzeitsmahl war gewöhnlich im Wirtshaus. Das Hochzeitspaar hat einen Vortanz und während des Mahles wurde es durch Aufhängen von Schlotzern, Püppchen und ähnlichem vor seinen Augen geneckt. Nach der Polizeistunde begab sich das Ehepaar unter Musik und Begleitung anderer Gäste nach Hause, wo noch Kaffee verabreicht wurde. Die Kaffee kochende Person (gewöhnlich eine Verwandte) ließ das Ehepaar nicht ins Haus, bis der junge Ehemann ihr ein Geschenk versprochen hat. Am nächsten Sonntag war die Nachhochzeit, nach vier Wochen der feierliche Besuch der Eltern, wenn diese auswärts wohnten.
Fingernägel nicht schneiden – nur abbeißen
Weit verbreitet war der Aberglaube: Den kleinen Kindern sollte die Mutter die Fingernägel abbeißen und nicht abschneiden, damit aus den Kleinen keine Langfinger werden. Wenn einem beim Reisen zuerst eine alte Frau begegnete oder ein Hase den Weg kreuzte, kehrten manche Menschen wieder um, weil sie ihren Gang als erfolglos ansahen. Bei abnehmendem Mond wurde nicht geschlachtet, weil man glaubte, der Speck laufe beim Räuchern aus.
Über die Vorboten des Todes
Den Tod glaubte man durch Vorboten oder das Anmelden des Todes zu erkennen. Bei einem Todesfall wurden die Uhr, die Blumentöpfe und anderes gerüttelt. Zur Leichenwache ging von jeder Familie jemand ins Trauerhaus, wo der Rosenkranz gebetet und Kaffee verabreicht wurde. In den Sarg gab man einen Rosenkranz mit. Die auswärts wohnenden Verwandten wurden durch den Leichenbitter geladen. Die Geladenen nahmen am Leichenmahl teil; ebenso die Nachbarn und Verwandten im Ort. Das Leichenmahl war im Trauerhaus, manchmal auch im Wirtshaus, die Trauerzeit für Erwachsene betrug ein Jahr, für Kinder ein Vierteljahr. Es wurde nicht gern gesehen, wenn einem Leichenzug eine Person oder ein Fuhrwerk begegnete, auch sah man es als ein schlimmes Vorzeichen an, wenn am Freitag ein Grab gegraben werden musste. Die Kinder erhielten in manchen Häusern vom Wachsstock gleich lange Stümpfchen abgeschnitten; wessen Stümpfchen zuerst abbrannte, der müsse zuerst sterben.
Schmuggel kein Vergehen
Zum Haus- und Hofsegen besuchten Bauherr und Bauleute vor der Hausaufrichte den Gottesdienst, danach war ein Mahl beim Bauherrn für die Bauleute; auch Verwandte und Nachbarn wurden geladen. Als Rechtsbräuche kennt Martus, dass man beim Dingen von Dienstboten diesen Haftgeld gab. Dienstwechsel war am Bündelestag (27. Dezember). Bei Kaufverträgen gab es Bier oder Wein, bei Versteigerungen im Wirtshaus wurden die Anwesenden vom Versteigernden freigehalten. Hier fügt Martus an: „Den Schmuggel halten die meisten Leute für kein Vergehen.“
Die Sichelhenke wurde mit Küchlein und Bier gefeiert, in der Nacht zum 1.¦Mai setzen die Burschen den Mädchen Tännchen auf den Brunnenstock, manchmal zum Spott auch auf den Düngerhaufen. Am Nikolaustag wurden die Kinder von ihren Taufpaten mit Kleidungsstücken, Spielsachen und Esswaren beschenkt. In der Neujahrsnacht spielt man in den Wirtshäusern gebackene Ringe aus. An Dreikönig war die Salz- und Wasserweihe, an Lichtmess Kerzenweihe. Am Agathatag wurde in Stube, Küche und Stall gegen Feuerschaden gebetet und im Sommer erbat man den Wettersegen. Am Fastnachtsmontag gab es ein Schauspiel im Freien, danach Tanz. Am Dienstag und Mittwoch wurde „Blauen“ gemacht und am Aschermittwoch der „Bandle“ begraben und danach traf man sich zum Stockfischessen. Das Scheibenschlagen war üblich und früher der Pfingstreiter oder -putzli mit Ertränken desselben im Brunnentrog. Zum Kirchweihtanz war ein Gottesackerbesuch in Prozession.
Manche Begriffe gibt es noch heute
Himmelfahrt hieß, wie heute noch in der Schweiz, Ufffahrt, Fronleichnam war der Herrgottstag – wobei wir schon beim Thema Sprache wären. Statt letztes Jahr sagte man s‘fändrig Johr, statt sauber sufer. Der Wittwer hieß Wittmann oder Wittlig, die Wittwe Wittfrau. Als Willkommensgruß verwendeten die Grimmelshofer früher unter anderem Gottwilchen, was so viel heißt wie Gott willkommen; Abschiedsgrüße lauteten Viel Glück, Kämmet bald wieder, N‘anders Mol!, aber auch Machet Fürobed!, Nähmet au z‘Obed!. Musste jemand niesen, sagte man Helf dr Gott! Zu den Lippen sagte man Lätsch, Schnupfen hieß Pniesel, der Ringfinger Goldfinger. Statt einer Jacke trug man einen Dschoba, das Fazinetli war das Taschentuch und Stößli Pulswärmer. Den Metzger nannte man Mexer, eine Schappelle war ein Stuhl ohne Lehne.
Grusselbeeri und Wälderbeeri
Die jungen Ziegen hießen Gitizli oder Häddeli, das Schwälmli war eine Schwalbe, der Hähliweih ein Hühnerhabicht, ein Wurmnosle eine Ameise und Molleköpfli waren Kaulquappen. Als Hundenamen waren verbreitet: Senti, Wemmo, Mohrli, Waldmann, Daggerli, Mento, Nero und Ami. Zur Johannisbeere sagte man Gniwürgele, zur Stachelbeere Grusselbeeri und zu Heidelbeeren Wälderbeeri. Nüsse wurden nach Hocken verkauft (vier Stück). Lehrer Martus hat die Umfrage so ausführlich beantwortet, dass hier auch bei den Dialektausdrücken nur ein Bruchteil genannt werden konnte.
Lesen Sie hier einen weiteren Teil über den historischen Fragebogen in Grimmelshofen.