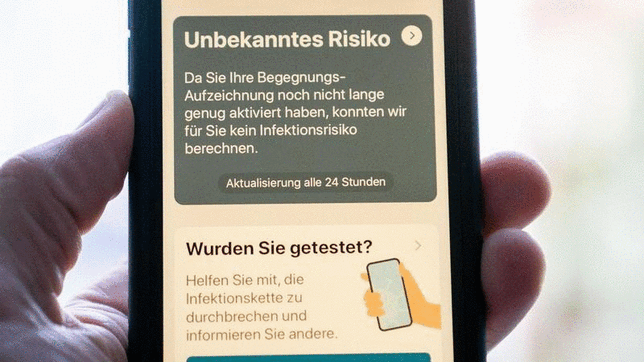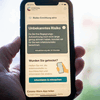Die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen steigt in der Schweiz seit Tagen an und auch auf deutscher Rheinseite werden wieder mehr Neuinfektionen gemeldet. Die Corona-Warnapp soll helfen, Risikokontakte zu erkennen und eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Doch es ist bekannt, dass die deutsche App und ihr eidgenössisches Pendant, die Swiss-Covid-App, nicht miteinander kompatibel sind und keine Daten austauschen.
Vor allem in der Grenzregion am Hochrhein ein Problem. In der EU sollen voraussichtlich schon ab Mitte bis Ende August die Corona-Apps von zehn verschiedenen Ländern miteinander kommunizieren können – die App des jeweiligen Heimatlandes reicht dann aus, um Warnsignale von Corona-Apps anderer Länder zu empfangen. Allerdings gilt dieses internationale Miteinander der Corona-Apps nicht für die Schweizer Covid-App, wie jüngst im Rahmen eines Pressegesprächs des Schweizer Bundesamts für Gesundheit (BAG) deutlich wurde. Der Grund: Eine EU-Richtlinie, derzufolge dieser Datenaustausch mit dem Nicht-EU-Mitgliedsstaat Schweiz nicht erlaubt ist.
Technisch keine Schwierigkeiten
Dass eine baldige Klärung in absehbarer Zeit kommt, darauf hoffen viele. Doch: „Nach derzeitigem Stand ist keine Lösung in den kommenden zwei oder drei Monaten in Sicht“, dämpft Sang-Il Kim die Hoffnung. Der Leiter Abteilung Digitale Transformation und Mitglied der Geschäftsleitung des BAG erklärt: „Technisch ist es kein Problem den Daten-Austausch der Apps beider Länder einzurichten. Wir sind mit den deutschen Kollegen in engem Austausch.“ Das bestätigt Mathias Wellig, CEO des Schweizer App-Entwicklers Ubique. An den rechtlichen Voraussetzungen können die App-Spezialisten allerdings nichts ändern.
„Natürlich ist es in unserem Interesse eine Lösung zu finden“, betonen die Schweizer Experten. Verhandlungen und Bemühungen liefen auf unterschiedlichen Ebenen. Diplomatisch sei es eine „heikle Mission“, einen Sonderweg für die Corona-Apps zu finden, der das so genannte Gesundheitsrahmenabkommen mit der Patientenmobilitätsrichtlinie der Regelung der Gesundheitsversorgung von EU-Bürgern in anderen EU-Ländern, umgeht. Aber: „Wenn es hier einen Weg gibt, die rechtlichen Voraussetzungen anzupassen, dann sind wir zuversichtlich, eine schnelle Lösung zu finden“, erklärt Sang-Il Kim.
Was sagt der Europaabgeordnete?
Und wie wird die Situation seitens der EU beurteilt? Andreas Schwab (CDU) ist Abgeordneter im Europäischen Parlament für Baden-Württemberg. Er erklärt auf Anfrage: „Als Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments für die Schweiz, werbe ich seit Jahren für eine engere Zusammenarbeit. Alle hätten davon zu gewinnen. Leider tut sich die Schweizer Seite damit seit Jahren schwer. Deswegen muss die Schweiz ihren Bürgern erklären, weshalb es bislang nicht zu einem Gesundheitsabkommen gekommen ist.“
Schwab erklärt, dass es aus Sicht der Europäischen Union „eine gute Sache“ wäre, die sich „unmittelbar nach dem seit Jahren von der Schweiz aufgeschobenen Rahmenabkommen ausverhandeln ließe.“ Er weißt darauf hin, dass zwischen Deutschland und der Schweiz sowohl das Rahmenabkommen als auch ein Gesundheitsabkommen Rechtssicherheit schaffen würde. Denn dies sei nicht nur bei sensiblen Daten wie bei Tracing-Apps besonders wichtig. Der Abgeordnete wolle weiter für eine bessere Zusammenarbeit auch ohne EU-Mitgliedschaft der Schweiz werden.