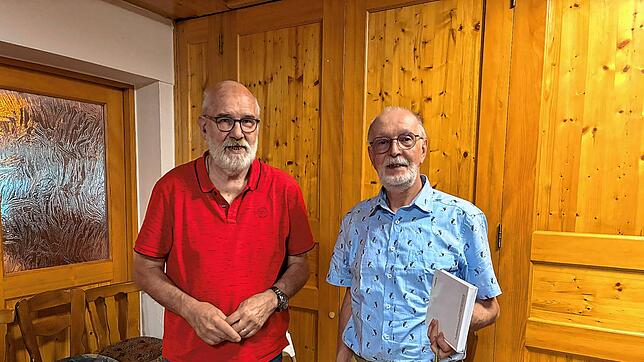Waldshut-Tiengen Beim jüngsten Monatstreff des Geschichtsvereins Hochrhein ist auch das Thema aus der jüngeren Geschichte gestammt. Während sonst meist auf Ereignisse früherer Jahrhunderte geblickt wird, referierte Klaus Teufel bei der jüngsten Ausgabe im Waldshuter Schützenhaus über das Jubiläum 50 Jahre Waldshut-Tiengen. Er sei von Geburt an Waldshuter, aber seit 1975 Waldshut-Tiengener, stellte er fest. Neben seiner Sicht als Einwohner befähigt ihn die Tatsache als Referent, dass er in jenem spannenden Jahr vor einem halben Jahrhundert seine Ausbildung bei der Stadtverwaltung begann. So konnte er aus seinem reichen Erfahrungsschatz berichten, was die Zuhörer dankbar annahmen.
Zunächst skizzierte Teufel die Gebietsreform in Baden-Württemberg in den Jahren 1968 bis 1975. Der Prozess der Gemeindereform brachte für die bis dahin eigenständigen Städte Waldshut und Tiengen und die Gemeinden Gurtweil sowie die Dörfer der Umgebung große Veränderungen mit sich. Einige Orte waren schon zu Waldshut oder Tiengen eingemeindet, im Januar 1974 fand eine Bürgeranhörung zur Vereinigung der Gemeinden Aichen, Krenkingen und Gurtweil mit den Städten Tiengen und Waldshut statt. War man in Waldshut für diese neue Stadt Waldshut-Tiengen, stimmten die Gurtweiler und vor allem die Tiengener dagegen. Dennoch beschloss der baden-württembergische Landtag im Juli 1974 den Zwangszusammenschluss mit Wirkung zum 1. Januar 1975. Gegen dieses Gesetz erhob die Stadt Tiengen Klage beim Staatsgerichtshof Baden-Württemberg.
Teufel beleuchtete die Zeit in der Schwebe mit Übergangsgemeinderat und einem Amtsverweser anstelle eines Bürgermeisters. Für dieses Amt setzte sich Franz-Joseph Dresen gegen den damaligen Waldshuter Bürgermeister Dr. Friedrich Wilhelm Utsch durch. Nach der Wahl des Gemeinderats im April 1975 musste sich dieser wegen der Klage der Stadt Tiengen auf wenige Themen beschränken. Mit dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom 11. Juli 1975 war es amtlich: die Stadt Waldshut-Tiengen bleibt bestehen. Nun konnten Bürgermeisterwahl, Geschäftsordnung und vor allem Haushaltsplan vorangebracht werden. Am 5. Oktober wurde Franz-Joseph Dresen zum Bürgermeister Waldshut-Tiengens gewählt und am 20. Oktober 1975 auf dieses Amt verpflichtet. Eine Woche später wurde der Antrag auf Erhebung der Stadt Waldshut-Tiengen zur Großen Kreisstadt beschlossen, dem das Innenministerium mit Wirkung zum 1. Juli 1976 stattgab. Franz-Joseph Dresen durfte sich somit fortan Oberbürgermeister nennen.
Vieles galt es zu regeln und zu klären, teils auch Kurioses, legte Teufel dar: Der Gemeinderat befasste sich mit einem Antrag auf Verbot der Prostitution im Stadtgebiet. Weil die Stadt durch den Zusammenschluss mehr als 20.000 Einwohner hatte, wäre diese erlaubt gewesen. Drängend war die Zusammenlegung der Verwaltungen mit der räumlichen Verteilung der Ämter sowie der Besetzung der Amtsleiterstellen. Sachgebiete mussten wegen unterschiedlicher Handhabung teils neu geordnet werden, Akten fanden massenweise ein neues Zuhause. Teufel erinnert sich noch sehr gut, „dass dies ein Kraftakt im wahrsten Sinne des Wortes war, der mir als damaligem Beamtenanwärter manchen Muskelkater bescherte, weil wir alle kräftig mit anpackten“. Zunächst hatten die Rathäuser in Tiengen und Waldshut noch unterschiedliche Rufnummern mit zwei verschiedenen Vorwahlen, was sehr bürgerunfreundlich war; verwaltungsintern spielten die beiden Telefonistinnen eine große Rolle. Anfang der 1990er-Jahre wurden im Zuge von Straßenarbeiten stadteigene Telefon- und Glaskabel zwischen den Rathäusern Tiengen und Waldshut verlegt. Dies war für die damalige Zeit ein technischer Meilenstein, von dem die Stadt auch heute noch profitiert, weil es innerhalb Waldshut-Tiengens auch nach 50 Jahren immer noch vier verschiedene Ortsvorwahlen gibt. Weiter wusste Teufel von der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung zu berichten, aber auch von den Automatisierungssystemen zuvor, beispielsweise der Adressiermaschine Adrema, von der er bei der Ausmusterung die Metallplatte mit seinen eigenen Daten rettete und sie den interessierten Zuhörern somit noch zeigen konnte.
Ende der 1980er-Jahre wurden die ersten Personal-Computer angeschafft, später machte es die rasante Entwicklung der Datenverarbeitung erforderlich, in den Rathäusern eigene Server aufzustellen und ein PC-Netzwerk aufzubauen. Teufel nannte weitere anschauliche Beispiele, an denen sich Schwierigkeiten, aber auch Nutzen der Gemeindereform gut ablesen lassen. Darunter die Zusammenlegung der Registraturen und Archive, die Vereinigung der Baubetriebshöfe in einen Neubau im Kaitle und dort ebenfalls die Errichtung eines Feuerwehrhauses oder die Zusammenlegung der beiden Stadtgärtnereien in das Betriebsgebäude in der Waldshuter Schmittenau.
Abschließend berichtete Teufel vom Entstehungsprozess des Stadtwappens, was einen eigenen Vortrag wert wäre. Hier erwähnte Teufel auch einen Wappenentwurf von Friedrich Durst. Die Ausstellung über ihn im Museum Alte Metzig in Waldshut besucht der Geschichtsverein Hochrhein beim nächsten Monatstreff am Donnerstag, 4. September, um 19 Uhr.