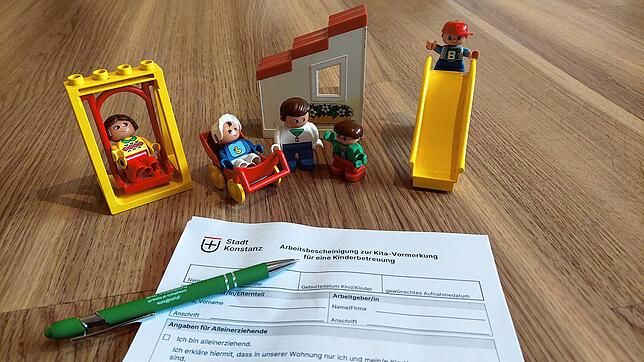Das Formular, das Eltern in diesen Tagen ausfüllen müssen, wenn sie einen Kita- oder Hortplatz für ihr Kind beantragen möchten, ist ungewohnt übersichtlich. Während in früheren Jahren neben der wöchentlichen Arbeitszeit auch noch Fragen zum Arbeitsweg, zu Schichtdienst, unregelmäßigen Arbeitszeiten, Geschwisterkindern und über zu pflegende Angehörige im eigenen Haushalt zu beantworten waren, ist die Abfrage jetzt sehr schlank gestaltet.
Das detaillierte Punktesystem, das bislang über die Vergabe der Kitaplätze entschied, wird auf ein Minimum reduziert. Dies beschlossen die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses einstimmig in der Sitzung von November 2024 und lösten damit die alte Fassung von 2018 ab. In Kraft trat die neue Version zum 1. Januar 2025. Zum Tragen kommt sie erstmals im März, wenn sich alle Konstanzer Kitas zur großen Vergabekonferenz treffen.
Familien mogelten sich zum Kita-Platz
Bislang gab es allein sieben verschiedene Stufen und somit zwischen einem und sieben Punkten dafür, wie viel die Eltern arbeiten. Fünf weitere Bonuspunkte wurden verteilt, wenn das vorgemerkte Kind ein Zwillings- oder Mehrlingskind ist. Auch der Wechsel der Einrichtung oder aus Tagespflege in eine Kita wurde mit einem Punkt belohnt, Geschwister erhielten drei Pluspunkte.
Warum zählt das alles jetzt nicht mehr oder deutlich weniger? Die Arbeitszeit der Eltern als Hauptkriterium für einen Kita- oder Hortplatz „hat sich in den letzten Jahren als zunehmend schwierig erwiesen, da die Richtigkeit der Angaben schwer zu überprüfen ist“, heißt es in der Sitzungsvorlage des Jugendhilfeausschusses.

In der Tat hatten sich immer wieder Eltern darüber beschwert, dass andere Familien sich mit falschen Angaben zu einem Platz mogelten, indem sie sich zum Beispiel zum Schein für ein Studium einschrieben oder den Wohnsitz der Konstanzer Großeltern angaben, während die Familie in der Schweiz lebte. Künftig soll deshalb vor allem das Alter der Kinder zählen.
Bei der Vergabe von Plätzen für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung werden ab sofort die Älteren vor den Jüngeren bevorzugt. Neu ist auch, dass Vorschulkinder Vorrang haben. Wie viel die Eltern arbeiten, ist unerheblich – außer bei Ganztagsplätzen. Hier wird, nachdem das Alter des Kindes im ersten Schritt maßgeblich war, im zweiten Schritt unter den ausgewählten Kindern nach Arbeitstätigkeit und -umfang ihrer Eltern entschieden.
Bei Krippenkindern läuft es etwas anders
Sich doch weiterhin auf den Beruf der Eltern zu stützen, sei „nach vielen Diskussionen in der Arbeitsgruppe und mangels Alternativen“ so vorgeschlagen worden, schreibt Joachim Krieg vom Sozial- und Jugendamt.
Bei Kleinkindern läuft es etwas anders. Sich hier nur auf das Alter der Kinder zu stützen, würde nicht zum Ziel führen. „Dann wären in den Krippen nur knapp Dreijährige“, so Joachim Krieg. Doch für die Einrichtungen ist eine Altersmischung wichtig; schließlich werden in einigen Häusern auch sechs Monate junge Kinder betreut.
Deshalb zählt für die Aufnahme von Krippenkindern weiterhin die Tätigkeit der Eltern. So ist es auch bei den Schulkindplätzen im Hort. Allerdings muss die Hortplatzvergabe ab dem Schuljahr 2026/27 überarbeitet werden, wenn Familien einen Rechtsanspruch auf Betreuung an den Grundschulen haben.
Das Alter der Kinder spielt dennoch auch bei Hortplätzen eine Rolle: Erst- und Zweitklässler sollen bei gleicher Punktzahl vorrangig aufgenommen werden. Der Geschwisterbonus wird künftig schwächer gewichtet. Denn „die bisherigen drei Punkte für Geschwisterkinder führten dazu, dass Kinder ohne Geschwister kaum noch eine Chance hatten, aufgenommen zu werden“, sagt Joachim Krieg.
Neu ist auch, dass Kinder möglichst in ihrer Wunscheinrichtung oder wohnortnah untergebracht werden sollen. Bislang kam es immer wieder vor, dass ein freier Platz nicht mit der nächsten Familie auf der Vergabeliste zusammenpasste, weil die Kita zu weit weg vom Wohnort lag. Oft wurden die Plätze dennoch angenommen und kurz darauf Anträge auf einen Kitawechsel gestellt – für alle Beteiligten viel Aufwand, für das Kind zu viel Umgewöhnung.

„Es bleibt bei der Mangelverwaltung“
Heike Kempe vom Vorstand des Konstanzer Gesamtelternbeirats (GEB) Kita begrüßt die neuen Richtlinien: „Das ist jetzt ein Stück weit fairer. Es werden Kriterien so weit wie möglich gemieden, bei denen man schummeln kann.“ Die Stadt werde auch weiterhin die Arbeitsbescheinigungen überprüfen und bei Bedarf weitere Informationen anfordern, teilt die städtische Pressestelle mit.

Aber Heike Kempe bedauert auch: „Leider bringt uns das nicht mehr Plätze, sondern es bleibt bei einer Mangelverwaltung.“ Das bestätigt die Stadt auf Nachfrage: Derzeit stehen rund 350 unversorgte unter Dreijährige und etwa 280 über Dreijährige auf der Vormerkliste.
Laut Stadt ist die tatsächliche Anzahl der Kinder ohne Kitaplatz aber etwas geringer: Nicht alle Eltern geben an, dass ihr Kind bereits einen Platz hat und nur die Einrichtung wechseln möchte. Auch der Fachkräftemangel bleibt hoch: Aktuell gibt es in den städtischen Einrichtungen zwölf offene Vollzeitstellen für Erzieherinnen und Erzieher. Aber auch diese Zahl schwanke fast täglich, so die Stadt.