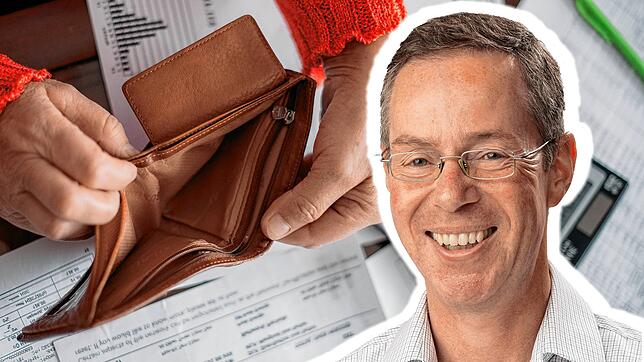Herr Baumgärtner, wir leben auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Und trotzdem streben wir immer weiter nach Wachstum. Kann das langfristig funktionieren?
Nein. So wie wir heute wirtschaften, wird das nichts. Unser Wirtschaftsmodell, die Marktwirtschaft, stellt sehr stark das Individuum und die Maximierung der Wohlfahrt dieses Individuums in den Mittelpunkt. Aber seit den 1960er- und 70er-Jahren merken wir, dass unser Planet Grenzen hat, die wir gerade massiv überstrapazieren. Und diese müssen irgendwie berücksichtigt werden. Das ist in der Idee der Marktwirtschaft aber gar nicht verankert. Die Grenzen zu ignorieren ist aber auch keine Option, da die natürlichen Lebensgrundlagen des Planeten unseren Wohlstand sichern.
Wieso wollen wir denn immer weiter wachsen, anstatt diese Grenzen zu respektieren?
Weil wir uns an diese Zielvorstellung von Wachstum angepasst haben. Ursprünglich – nach dem Zweiten Weltkrieg – gab es ja auch sehr gute Gründe für Wirtschaftswachstum. Was den Menschen fehlte, musste erst wieder produziert werden. Aber diese Gründe sind seit ungefähr Mitte der 1970er Jahre weggefallen. Seither führt in Deutschland wie in anderen hoch entwickelten Volkswirtschaften weiteres Wirtschaftswachstum nicht mehr zu einer Erhöhung des Wohlergehens der Menschen. Und jetzt taucht die Frage auf: „Sind wir möglicherweise abhängig vom Wirtschaftswachstum, weil wir unsere Systeme so konstruiert haben, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, um sie am Laufen zu halten?“
Welche Systeme meinen Sie?
Zum Beispiel das Rentensystem. Wenn das Bruttoinlandsprodukt – also die Wirtschaft – zurückgeht, wird weniger produziert. Das heißt, wir haben eine geringere Wertschöpfung, und das bedeutet weniger Beschäftigung – und das wirkt sich auf die Rentenbeiträge aus. Das, was rausgeht, muss aber auch reinkommen, sonst gibt es ein Problem.
Kann man daran etwas ändern?
Wir haben die soziale Sicherung in Deutschland nahezu komplett an die Lohnarbeit gekoppelt. Das kann man natürlich auch anders machen – zum Beispiel über Steuern, Einkunftsarten oder Kapitalerträge. Aber auch unser ganzes Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgerichtet. Unternehmen finanzieren sich über Kredite oder Börsengänge. Das funktioniert nur, wenn sie versprechen, dass sie in Zukunft mehr Geld machen als heute. Also produzieren und exportieren wir immer weiter – zur Not halt nach China.
Brauchen wir also ein völlig neues Wirtschaftsmodell – oder reicht es, das Bestehende zu reformieren?
Ich tue mich schwer, für den ganz großen Wandel zu argumentieren. Die Marktwirtschaft ist meiner Meinung nach das beste System, das wir haben – auch um den Klimawandel zu begrenzen. Aber wir müssen ganz grundsätzlich etwas verändern und nicht nur einen Benzinsteuersatz hier und einen Mehrwertsteuersatz da anpassen. Ich würde aber nicht beim Wachstum anfangen – das ist nämlich nicht zwangsläufig schlecht. Ich würde bei der Vision eines besseren Lebens anfangen.
Das müssen Sie erklären.
Wenn wir heute bei null anfangen könnten, würde niemand das System so entwerfen, dass wir morgens eine Stunde im Stau stehen – und am Abend gleich nochmal. Das wäre idiotisch. Grüne Innenstädte die vier Grad kühler sind als heute, so stellt man sich die Zukunft vor. Und damit sollten wir anfangen. Ich glaube, ein gutes Leben ist automatisch eines mit weniger Energieaufwand, weniger Ressourcenverbrauch, weniger Konsum. Dafür mehr Freizeit. Die Leute sollen nicht auf Dinge verzichten, die sie brauchen, sondern auf Sachen, die sie eh nicht wollen.
Klingt nach einer schönen Utopie. Aber wie kommen wir dorthin?
Ich glaube, Deutschland konzentriert sich zu sehr auf Klimaschutzziele der einzelnen Sektoren. Wir sollten zuerst die Emissionen vermeiden, die am günstigsten zu vermeiden sind. Und das beste Mittel, um diese zu finden, ist der CO2-Preis. Ich würde also nicht bei den technischen Lösungen anfangen und diese gegen alle Widerstände durchdrücken. Was dann passiert, haben wir in den vergangenen Jahren beim Heizungsgesetz gesehen.
Der massive Widerstand, den es dagegen gab – mit so einem Brecher bei den Gebäuden einzusteigen – könnte so interpretiert werden, dass dort die Kosten der Einsparung sehr hoch sind. Wohingegen sich beim Strom noch kaum jemand beschwert hat, wenn der grün aus der Steckdose kommt. Ich würde deswegen empfehlen, stark auf einen einheitlichen CO2-Preis und ein System handelbarer Emissionszertifikate zu setzen. Dann können die Menschen selbst entscheiden, wo sie am einfachsten und günstigsten Emissionen reduzieren können.
Aber wenn alles teurer wird, können sich Menschen mit niedrigen Einkommen irgendwann gar nichts mehr leisten.
Das war eine der Todsünden der Umweltpolitik der letzten Jahre – dass der CO2-Preis eingeführt und erhöht wurde, aber keine Rückerstattung dieser Einnahmen erfolgt ist. Und auch die jetzige Regierung plant das nicht. Das wird die soziale Akzeptanz von Klimaschutz nicht erhöhen. Der CO2-Preis muss selbstverständlich an die Bevölkerung zurückgegeben werden – in Form eines einheitlichen Klimabonus etwa.
Höhere CO2-Preise sind ein super Signal über die ganze Wirtschaft hinweg, belasten aber erstmal Haushalte mit niedrigen Einkommen am stärksten, weil sie jede Preissteigerung direkt spüren. Aber wenn alle den gleichen Klimabonus zurückerstattet bekommen, ist es genau umgekehrt. Denn zwei Drittel der Emissionen stammen aus dem Konsum der reichsten zehn Prozent der Bevölkerung. Sie müssen also viel mehr zahlen.
Aber wann setzen wir dann echte Klimaschutzmaßnahmen um?
Sobald wir wissen, welche am günstigsten zu vermeiden sind – und zwar nur die, die günstiger sind als der aktuelle CO2-Preis. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
Wie jetzt? Müssen wir nicht innerhalb der Grenzen des Planeten leben?
Der Anteil Deutschlands an den weltweiten CO2-Emissionen liegt bei etwa zwei Prozent. Selbst wenn wir es schaffen würden, unsere Emissionen auf null zu reduzieren, bringt das für den Klimawandel fast gar nichts. Klimaschutzmaßnahmen, die von Deutschland ausgehen, machen nur als Hebelwirkung auf China, Indien oder die USA Sinn. Dort entstehen die meisten Emissionen. Wir sollten also die Art von Klimaschutz machen, die China braucht.
Und was braucht China?
Damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt der Diskussion. Die schauen natürlich auf unser Wohlstandsmodell. Ich glaube, unsere Verantwortung könnte sein, zu demonstrieren, wie man ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Ziel so gestaltet, dass es Wohlergehen für die Bürger stiftet, ohne den Planeten zu zerstören. Dazu gehört auch, Wirtschaftszweige wie die Industrie im eigenen Land zu halten – und zu demonstrieren, dass man so produzieren kann, dass es mit dem Planeten vereinbar ist.
Und das alles schafft ein gut gestalteter CO2-Preis?
Nicht nur. Hier kommt die Politik ins Spiel. Die Abkehr vom „immer größer, immer mehr“ muss zelebriert werden. Die Politik ist dafür zuständig, diese Vision konsistent zu verbreiten – und durch politische Entscheidungen und ein paar regulierende Eingriffe zu ermöglichen. Wenn der CO2-Preis die Umweltkosten von Kohlenstoff sowie seine Knappheit widerspiegelt, dann werden die Menschen ganz von selbst merken, dass es nicht schlau ist, mit Öl und Gas zu heizen. Dazu brauchen sie ein Bild davon, wie ein gutes Leben aussieht – in dem die Menschen zufrieden sind und wir ein Vorbild für Indien und China sein können.
Ist die Wärmeplanung in Konstanz also Quatsch?
Wärmeplanung ist ein gutes Stichwort. Da hat der Bund seine Verantwortung erkannt. Deswegen werden Kommunen je nach Größe dazu verpflichtet. Das ist ein super Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Das spart nicht nur CO2, sondern daraus entsteht für die Kommune auch ein räumlich begrenzter Vorteil – zum Beispiel durch Unabhängigkeit von Energieimporten. Außerdem können solche Projekte wie die Seewärme in Konstanz als Vorbilder für China dienen. Ich würde jetzt aber nicht wahllos irgendwelche Gebäude sanieren.