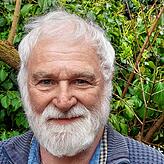Natalie Pickartz schiebt ein großes weißes Gerät über das Kopfsteinpflaster und eine Rasenfläche am Pfalzgarten hinter dem Münster. Hin und her, immer wieder, auf dem Boden ausgelegten Fäden folgend. Es sieht so aus, als würde sie einen großen Rasenmäher bedienen. Doch die Geophysikerin möchte nichts auf der Oberfläche entfernen, sondern unter die Erde blicken.
Das Gerät nennt sich Bodenradar. Damit kann Natalie Pickartz zwei bis drei Meter unter die Erde schauen, ohne die Fläche aufgraben zu müssen. Die Fäden liegen auf dem Boden, damit sie die Orientierung behält. „Im Gegensatz zum Rasenmäher sieht man hier nicht, wo man schon langgefahren ist“, sagt die Wissenschaftlerin und lacht.
Alle vier Zentimeter löst der Bodenradar eine Messung aus. Die Informationen bündeln sich im Gerät, bis ein dreidimensionales Schwarz-Weiß-Bild vom Untergrund auf einem kleinen Bildschirm erscheint. „Das ist die Rasenkante und hier erkenne ich eine Leitung im Boden“, erklärt die Geophysikerin. Mehr können die Laien nicht sehen, die Aufnahmen ähneln Ultraschallbildern.
„Das ist wie eine Schatzsuche“, sagt Natalie Pickartz. Denn auch sie kann nicht an Ort und Stelle erkennen, ob sich beim Pfalzgarten unbekannte Spuren keltischer oder römischer Siedlungen verstecken. „Ich muss die Bilder erst in Ruhe auswerten, vor Mai rechne ich nicht mit einem Ergebnis“, sagt sie. Für die Archäologie ist das Bodenradarmessgerät sehr wertvoll.

„Die Technik hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert“, sagt Caroline Bleckmann vom Landesamt für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart. Üblicherweise wird der Bodenradar eher auf dem freien Feld eingesetzt. „In einer Stadt ist der Untergrund oft so verdichtet, dass sich die Schichten überlagern. Aber jetzt zeigt sich, dass das Gerät auch im Pfalzgarten durchkommt.“
Was könnten die Forscher finden?
Auch im Münster selbst kam der vermeintliche Rasenmäher in den vergangenen Tagen zum Einsatz. Ziel der Untersuchungen ist es, römische oder keltische Gräben, eine Innenbebauung des römischen Kastells auf dem heutigen Münsterplatz, den genauen Verlauf der spätrömischen Kastellmauer und frühmittelalterliche Siedlungsstrukturen aufzuspüren.

„Das kleine Projekt in diesen Tagen ist erst der Auftakt zu möglicherweise größeren Untersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt, auch Grabungen sind dann nicht ausgeschlossen“, sagt Aline Kottmann vom LAD, Standort Esslingen. „Konstanz ist der ideale Ort für uns, hier gibt es noch so viel Erhaltenes aus früheren Zeiten.“

Das Landesamt für Denkmalpflege arbeitet bei den Bodenradarmessungen mit der Stadt Konstanz zusammen. „Wir sind glücklich, dass wir neue Erkenntnisse über unsere Altstadt gewinnen“, sagt Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Der städtische Denkmalpfleger Frank Mienhardt ergänzt: „Wir haben einen großen Fundus an Ergebnissen seit den 1980er-Jahren. Die können wir jetzt gut mit den neuen Erkenntnissen verzahnen.“
Caroline Bleckmann zeigt eine Grafik mit vielen bunten Linien. „Wir haben am Münsterhügel seit den Kelten eine Besiedelung, also seit dem ersten Jahrhundert vor Christus“, erläutert sie. Auch römische Befestigungsanlagen seien hier zu finden. Manche Strukturen haben die Archäologen schon nachgewiesen, andere vermuten sie nur.
„Wir wissen zum Beispiel nicht genau, wo die spätrömische Kastellmauer unter dem Münster verläuft. Und es gibt hier auch einen Wehrgraben, wohl aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, aber wir wissen nicht, ob die bereits gefundenen Strukturen zusammengehören“, sagt Caroline Bleckmann und verdeutlicht: „Von dem großen Puzzle haben wir bisher nur einzelne Teile.“
Die Bodenradarmessungen sollen weiteren Aufschluss geben. „Wir können ja nicht die ganze Stadt ausgraben“, sagt Bleckmann und lacht. Aber auch an anderer Stelle in Konstanz kommt derzeit ausgeklügelte Technik zum Einsatz, um historischen Spuren auf den Grund zu gehen: Parallel zum Münsterhügel recherchiert das Landesamt für Denkmalpflege auch in der Konradigasse.

Denn es besteht die „berechtigte Annahme, dass sich dort eine uralte Stadtmauer befand“, wie es der bekannte Bauforscher Burghard Lohrum ausdrückt. Die Landesdenkmalpfleger Marianne Lehmann und Amed Furan dürfen deshalb in diesen Tagen einige Hauskeller in der Konradigasse untersuchen.
„Anhand der Vermessungen der Keller ergeben sich Höhen, Fluchten und Wandstärken, die auf einen Mauerzug von 1,60 Metern Stärke hindeuten“, sagt Burghard Lohrum. Das Alter zu bestimmen, sei nicht ganz einfach. „Vermutlich stammt die Mauer aus dem 11. oder 12. Jahrhundert“, sagt der Bauforscher. „Wir können das detektivisch anhand des Steinmaterials und Eigenschaften des Zerfalls bestimmen oder anhand der Häuser, die darauf stehen.“

Laut dem Konstanzer Denkmalpfleger Frank Mienhardt seien drei der Keller bereits früher dokumentiert worden, ein Haus in der Reihe habe gar kein Untergeschoss und zehn Stück werden derzeit untersucht. Die verwinkelten Räume zu vermessen, ist nicht einfach. „Wir machen das mittels GPS-Punkten und einem Tachymeter“, sagt Marianne Lehmann. Mit einem solchen Gerät können Entfernungen ermittelt werden, allerdings braucht es dazu in den Kellern der Konradigasse mehrere Spiegel, um auch um die Ecke messen zu können.
„Das Gerät baut Punktwolken aus Pixeln, danach erhalten wir ein farbiges 3D-Modell, das man am Computer drehen und wenden kann“, sagt Marianne Lehmann. „Über Nacht lasse ich die Bilder errechnen. Das ergibt riesige Datenmengen, aber der Aufwand lohnt sich“, ist sie überzeugt. Das meint auch Bauforscher Burghard Lohrum: „Es ist faszinierend, in das Wohnen vergangener Jahrhunderte hereinzuschauen. Das frühere Leben spiegelt sich über Umwegen oft noch heute in den Häusern wider.“