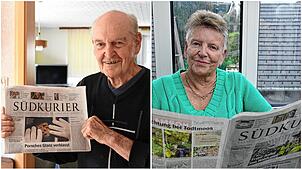Fünf Arbeitskräfte aus dem Bereich Pflege und einem anderen Bereich des Konstanzer Klinikums wollen die Situation nicht mehr hinnehmen. Sie haben den Kontakt zum SÜDKURIER gesucht und erzählen aus dem beruflichen Alltag.
„Die fatale Situation hat nicht unbedingt etwas mit Corona zu tun“, sagen sie unisono. „Das Virus war vielleicht ein Brandverstärker. Doch schon vorher waren die Zustände unerträglich. Und es wird immer schlimmer.“
„Kein Konstanzer Phänomen, sondern Realität in deutschen Krankenhäusern“
Die Klinik reagiert auf die schweren Vorwürfe auf Nachfrage des SÜDKURIER. Unter anderem heißt es in einer Stellungnahme: „Der Pflegemangel ist kein Konstanzer Phänomen, sondern Realität in deutschen Krankenhäusern in der ganzen Bundesrepublik. Die Pandemie hat den Mangel nur eklatant zu Tage gebracht.“
Pressesprecherin Andrea Jagode sieht sogar einen positiven Ansatz: „Zum ersten Mal seit langer Zeit sind die Pflege und die Situation der Pflegenden wirklich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Es ist gut, dass dieser Beruf, der einen Dienst an der Gesellschaft darstellt, endlich die Würdigung bekommt, die er verdient. Das ist eine der wenigen guten Seiten von Corona.“

Das Personal sei nach fast zwei Jahren Corona-Dauerstress im beruflichen und häuslichen Bereich müde und erschöpft, räumt sie ein. „Manch einer reduziert da seine Arbeitszeit, um etwas mehr für die eigene Erholung tun zu können – und um eben nicht dauerhaft krank zu werden oder den Job aufgeben zu müssen.“
Was sind die Kritikpunkte und wie reagiert die Klinik darauf?
- Kritikpunkt: Berufsethos der Pflegekräfte
„Wir sagen nie nein, auch wenn wir aufgrund von erkrankten Kolleginnen oftmals kaum Pausen zwischen den Schichten haben und ständig Überstunden machen müssen“, sagt eine Pflegerin. „Nur durch unseren Berufsethos funktioniert der Laden.“ Ein Vorwurf: Die Pflegedirektion würde dies ausnutzen.
Eine Kollegin nickt zustimmend. „Wir bezahlen unseren Einsatz für die Patienten mit unserer Gesundheit. Leute gehen heulend heim, können nicht schlafen, kommen nicht zur Ruhe. Das wirkt sich auch auf unser Privatleben und unsere Psyche aus.“ Doch anstatt sich zu wehren, würden sie immer weitermachen, erzählen sie. „Daher haben wir uns nun entschlossen, den Schritt an die Öffentlichkeit zu wagen.“ So wie bisher ginge es nicht mehr weiter, „denn was nützt eine fleißige Pflegerin mit tollem Berufsethos, wenn sie wegen der Belastung nicht mehr kann, lange selbst krank ausfällt oder den Beruf wechselt?“
Die Verantwortlichen der Klinik verneinen jedoch eine grundsätzliche Unzufriedenheit, wie Andreas Jagode schreibt: „Sicherlich wird die Situation vor Ort auf den Stationen von den einzelnen Pflegekräften unterschiedlich wahrgenommen und empfunden. Dass man von einer generellen systematischen Belastung aller Pflegekräfte sprechen kann, können wir so nicht unterschreiben. Das ist individuell sicherlich sehr unterschiedlich.“
- Kritikpunkt: Unterbesetzung beim Personal
Das ist ein grundsätzliches Problem der Pflege – bundesweit. „Auch bei uns sind manche Stellen nicht besetzt“, sagen die Pflegemitarbeiter. „Ein Problem: Unsere Geschäftsführung schickt neue Kolleginnen, die dann aber keine Ahnung haben, was sie tun sollen und oft kein Wort Deutsch sprechen.“ Die Folge: „Wir müssen diese liebenswerten Menschen, die ja nur helfen möchten, erst einmal einarbeiten und ihnen wichtige Begriffe auf Deutsch beibringen. Dadurch haben wir deutlich mehr zu tun.“
Dazu schreibt Andrea Jagode: „Diese Kolleginnen haben in der Regel in ihren Heimatländern Pflege studiert und müssen ein bestimmtes Sprachniveau nachweisen, um als Pflegekraft zugelassen werden zu können, Mindestvorgabe B2 Level. Sie müssen jedoch für eine bestimmte Zeit eingearbeitet und mit den deutschen Gegebenheiten vertraut gemacht werden. Das ist aber bei jedem Beruf so.“
Die Pflegekräfte kritisieren die geplanten Pflege-Pools. Mitarbeiter einer Station sollen auch auf anderen Stationen aushelfen. „Wir sind spezialisiert und können doch nicht einfach von einer Disziplin in die andere hüpfen“, sagen sie. Dem hält Andrea Jagode entgegen: „Alle Pflegekräfte haben einmal die gleiche Ausbildung durchlaufen und sind von daher qualifiziert, um mit Patienten zu arbeiten. Die Basistätigkeiten sind immer dieselben.“ Die Pflegekräfte berichten andere Dinge. „Natürlich gibt es ähnliche Tätigkeiten in allen Bereichen. Jedoch muss man dafür auch jeweils spezielle Aus- und Fortbildungen haben. Das geht nicht einfach so.“ Hier lauere eine Gefahr für Patienten.
- Kritikpunkt: Fehlende Wertschätzung
Die Pflegekräfte fühlen sich und ihre Leistungen nicht angemessen anerkannt. „Von den Oberen sehen wir keinen hier. Niemand möchte sich selbst ein Bild von den Zuständen machen. Die haben keine Ahnung. Wir sind doch dafür verantwortlich, dass die Versorgung überhaupt noch funktioniert.“ Um mehr Geld ginge es ihnen nicht unbedingt, „auch wenn dies gut tun würde. Vielmehr finden wir es schlimm, wie wenig Wertschätzung uns entgegen gebracht wird“.

Andrea Jagode weist diesen Vorwurf zurück: „Unsere Pflegedirektorin und das Care Manager Team sind regelmäßig auf den Stationen zugegen und befinden sich im ständigen Austausch mit den Mitarbeitenden.“ Die Pflegedirektion wisse, wie es auf den Stationen stünde. „Unserer Pflegedirektorin Carmen Passe ist eine wertschätzende Führung ebenso wichtig wie eine gute Gesprächs- und eine hohe Wertekultur. Sie legt großen Wert auf das gute Miteinander.“
Getreu dem Motto „Arbeitszeit ist Lebenszeit“ wolle die Pflegedirektorin mit dafür sorgen, dass jede Pflegekraft eine gute Perspektive im Haus habe. „Beschäftigte mit Problemen dürfen sich also gerne an sie und ihr Team wenden. Dieses Angebot an die Pflegebeschäftigten steht – es muss aber auch abgerufen werden.“
- Kritikpunkt: Keine faire Bezahlung
Eine Pflegekraft aus einer anderen Region Deutschlands ist über eine Zeitarbeitsfirma als Honorarkraft für mehrere Monate am Klinikum Konstanz beschäftigt. Nach eigenen Angaben verdient sie als Teilzeit 4000 Euro brutto, erhält dazu einen Dienstwagen mit Tankkarte ohne Limit sowie eine Dienstwohnung – bezahlt von der Zeitarbeitsfirma.
„Man kann sich vorstellen, wie viel Geld das Klinikum an die Firma bezahlt“, sagt sie. „Die möchte ja auch verdienen.“ Die Zeitarbeitsfirmen selbst geben keine Auskunft über die Bezahlung und Abrechnung ihrer Mitarbeiter. Eine festangestellte Kollegin mit ähnlichem Alter und ähnlicher Arbeitszeit verdient laut eigener Aussage 3250 Euro.
Wie viel Geld das Klinikum für eine Honorarkraft bezahlt? Auf diese Frage gibt es keine explizite Antwort. Lediglich diese Worte: „Um dem Pflegekräftemangel entgegenzuwirken, setzen wir im GLKN auch Honorarkräfte ein, so genannte Leasingkräfte. Externe Honorarkräfte werden über entsprechende Agenturen vermittelt, die sich die Vermittlung vergüten lassen. Welche individuelle Vergütung die über die Agenturen bereitgestellten Mitarbeiter erhalten, können wir dabei nicht beurteilen.“
- Kritikpunkt: Geschlossene Betten
Ein erfahrener Mitarbeiter findet diese drastischen Worte: „Fakt ist: Die Pflege im Haus ist ein einziger Verschiebebahnhof. Überall werden Löcher gestopft. Zum Glück ist Corona bei uns noch nicht so schlimm wie in Bayern. Aufgrund des Personalmangels sind einige Betten geschlossen, auch auf der Intensivstation. Als nächstes werden wir planbare OPs verschieben müssen, wenn es so weitergeht. Gegebenenfalls sogar Tumor-OPs.“
Die Pressestelle reagiert so: Dass einzelne Betten, auch auf den Intensivstationen, immer wieder geschlossen werden müssten, sei leider eine unvermeidliche Tatsache – in der ganzen Republik. Das sei kein Versagen unserer Krankenhausleitung, sondern habe ihre Ursache in den politischen Rahmenbedingungen. „Wir halten uns an die vom Gesetz vorgegebenen Pflegepersonaluntergrenzen. Diese Untergrenzen sollen die Patientenversorgung verbessern und das Pflegepersonal entlasten, denn sie legt für jeden pflegesensitiven Bereich stationsbezogen eine Mindestanzahl an Pflegekräften zur Versorgung einer festgelegten Anzahl an Patienten fest“, schreibt Andrea Jagode.
Werde im Monatsdurchschnitt weniger Pflegepersonal als vorgeschrieben eingesetzt, müsse das Krankenhaus Abschläge hinnehmen oder die Patientenzahl reduzieren. Reduktion der Patientenzahl bedeutet Bettenschließung. „Reduzierte Arbeitszeiten, Engpässe beim Pflegepersonal und der in den Wintermonaten erhöhte Krankenstand kann aufgrund der Verordnung zu Bettenschließungen führen.“