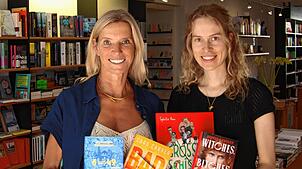Matilda bedeutet Macht (maht) und Kampf (hiltja). Es bedeutet „mächtige Kämpferin.“ Und Matilda, die als Frühchen zur Welt kam, musste sich in den ersten Wochen durchs Leben kämpfen.
Man kann nur erahnen, wie es für ein so kleines Wesen ist, vom geschützten Bereich des Bauchs ganz plötzlich auf einer großen, cleanen Intensivstation zu landen. Und doch hatte Matilda von Anfang an: „Einen enormen Willen und ein Selbstbewusstsein“, sagt ihre Mutter, Corinna Maier.
Sie wog so viel wie ein Pfund Mehl
Auf ihrem Handy scrollt sie durch ein Dutzend Fotos, die in den ersten Wochen nach der Geburt entstanden sind. Es sind intime Einblicke, in den Klinikalltag mit Frühchen während der Corona-Pandemie, als Besuche nur nach strengen Regeln möglich waren. Und jedes Bild, jeder Moment mit Matilda, dafür umso kostbarer war.
Auf einem Foto liegt Matilda im Inkubator auf der Neugeborenen-Intensivstation des Schwarzwald-Baar Klinikums. Sie ist winzig klein, die Haut noch feuerrot. Mit Händen, die nicht viel größer sind, als die Daumen eines kräftigen Erwachsenen. „Sie wog da kaum mehr als ein Pfund Mehl – 740 Gramm“, sagt Maier.
Auf einem anderen sieht sie aus, als würde sie schlafen. „Dabei hatte Matilda sich da gerade von ihren Beatmungsschläuchen befreit.“ Corinna Maier sagt, sie habe da schon gespürt, „dass die Kleine ganz genau weiß, was sie will. Und dass sie es sich zutraut, selbst zu atmen.“
Wie gut sie gewachsen sei, sagt sie und nimmt Matilda, mittlerweile ein Jahr alt, auf den Schoß. „Ist sie nicht schön!“ Ihr gegenüber sitzt Ulrike Moosmann, die als Kinderkrankenschwester und „Case Managerin“, wie sie sagt, mit den Verein „Der Bunte Kreis“ Frühchen, chronisch kranke Kinder und ihre Eltern in der sozialmedizinischen Nachsorge betreut. „Ein unheimlich wichtiges Angebot“, meint Maier, obwohl sie es anfangs gar nicht nutzen wollte. Weil es in das Bild passte, dass sie von sich hatte. „Ich brauche doch keine Hilfe, habe ich gedacht.“
Schließlich habe sie schon ein Kind, einen neunjährigen Sohn, und wusste, was nach der Geburt auf sie zukomme. Schließlich ist sie eine resolute Frau. Die mit ihrem Mann gerade ein Haus gebaut hat. Und mitten in der Corona-Pandemie, in den letzten Schwangerschaftswochen und ihrer ersten Zeit als Mutter, noch schnell einen Umzug stemmte.
Sie sei eben eine, die Verantwortung übernehme. Und funktioniere.

Das tat sie, bis Matilda nach zwei Monaten aus der Klinik nach Hause kam und Maier merkte, was viel sie geleistet hatte. Sie sei fast in ein Loch gefallen, war am Rande ihrer Kräfte.
„Dass du da warst, tat gut“, sagt sie zu Ulrike Moosmann. Mit der Kinderkrankenschwester konnte sie reden. Darüber, wie es sich anfühlte, in der 28. Schwangerschaftswoche auf den Ultraschall-Monitor zu blicken und nicht begreifen zu wollen, dass Matildas Herztöne ständig aussetzten. Darüber, wie sich Sorgen und Ängste in ihren Alltag schlichen.
„Es war wie ein Arbeitsschritt“
Die Sorge etwa ihr Kind könnte als Frühchen, nach einem Notkaiserschnitt, mit einer Behinderung zur Welt kommen.
Und auch darüber, wie es war, nach der Entlassung aus der Klinik, jeden Tag zurückzufahren und Matilda nur kurz sehen zu können. Weil die Besuchszeiten coronabedingt eingeschränkt waren und nur ein Elternteil bei ihr sein durfte.
Die Zeit beschreibt Corinna Maier in einem trockenen Satz: „Es war wie ein Arbeitsschritt.“ Zuhause habe sie die Milch für Matilda abgepumpt, sei in die Klinik gefahren und schlussendlich wieder Heim.

Wie es für sie war, in dieser fremden Umgebung, zwischen piepsenden Monitoren – und mit so kurzen Besuchszeiten – Nähe zu Matilda aufzubauen?
Maier überlegt einen Moment und sagt dann: „Es sind die kleinen Momente, die zählen.“
Etwa als sie Matilda in regelmäßigen Abständen auf die Brust gelegt bekam. Känguruhen, nennen Kinderkrankenschwestern wie Moosmann das. Weil die Frühchen, gut zugedeckt, wie im Beutel eines Kängurus, geborgen liegen und die vertraute Körperwärme, den vertrauten Herzschlag, spüren. Auch Maier empfand damals ein starkes Glücksgefühl.
Wenn es mit den Stillen nicht klappt
Doch eine Sorge blieb. „Matilda nicht stillen zu können.“ Dabei war sie doch so zart. Sollte wachsen und stärker werden. „Ich hatte Angst, dass sie nicht zunimmt.“ Eine Sorge, die Ulrike Moosmann von vielen Eltern kennt, deren Babys zu früh auf die Welt gekommen sind. „Es ist oft ein Teil der Nachsorge, eine gelingende Stillbeziehung zu fördern“, sagt sie.

Moosmann weiß, wie holprig die erste Zeit nach Geburt, und die erste Zeit zuhause, für Frühchen-Eltern ist und will helfen, dabei nicht zu stolpern. Deshalb unterstützt und berät sie Eltern in dieser Phase.
Sie schaut regelmäßig nach den Kleinsten, beobachtet ihre Entwicklung, gibt Tipps – und hört zu. „Man ist einfach nicht allein. Und fühlt sich sicherer, weil noch jemand da ist“, sagt Corinna Maier. Die Gespräche mit Moosmann hätten ihr, rückblickend, am meisten geholfen.
Eine Nachsorgeleistung, die die Krankenkasse übernimmt
Und auch die Kinderkrankenschwester ist längst nicht allein. „Beim Bunten Kreis sind wir ein interdisziplinäres Team.“ Da sei eine Sozialpädagogin, die Frühchen-Eltern bei rechtlichen Fragen unterstütze. Und da seien insgesamt vier Kinderkrankenschwestern und eine Kinderärztin, die regelmäßig nach den Babys und ihren Eltern schauten.
„Die Nachsorge geht meist über drei Monate. Das sind pro Familie dann ungefähr 20 Stunden an Hausbesuchen.“, sagt Moosmann. Eine Leistung, die seit 2010 auch von den Krankenkassen anerkannt und übernommen wird.
In manchen Fällen – wenn zum Beispiel ein Therapeut oder ein Augenarzt gebraucht wird – vermittelt der „Bunte Kreis“ auch an anderes Fachpersonal oder zu betroffenen Eltern. Denn nicht alle Frühchen entwickelten sich gut wie Matilda, sagt Moosmann.

Schon vor 14 Jahren, als der „Bunte Kreis“ sich langsam aufbaute, gehörte sie zum Team. Warum? „In der Klinik habe ich oft erlebt, wie zerrissen und erschöpft die Mütter sind.“
Zerrissen, weil sie sich meist noch um eine Familie, um ein Leben zuhause, kümmern mussten. Und erschöpft, weil – mit Frühchen – plötzlich viele ungeklärte Fragen im Raum standen. Und so manche Mutter nächtelang wach lag und nachdachte. „Für diese Mütter wollte ich da sein und sie ein bisschen an die Hand nehmen.“
Matilda war ein aufgewecktes Kind
Das Schöne für Ulrike Moosmann, die zu 40 Prozent im Schwarzwald-Baar-Klinikum auf der Frühchen-Station und zu 60 Prozent in der Nachsorge beim „Bunten Kreis“ arbeitet: Sie lernt die Kinder und deren Familien, die sie später begleitet oft schon in der Klinik kennen. Bei Matilda war das auch so.
„Und sie war schon da ein aufgewecktes Kind“, sagt die Kinderkrankenschwester.