Die Deutschen machen sich Sorgen. Den meisten Menschen geht es zwar gut, aber sie fürchten, dass das in absehbarer Zeit vorbei sein könnte. Die Kluft zwischen Arm und Reich, die Zuwanderung, die Digitalisierung des Alltags – lauter Themen, die der Einzelne nicht beeinflussen kann und die gerade deshalb Ängste auslösen.
Dabei hat das Land schon ganz andere Herausforderungen bewältigt. Ein Gespräch mit Eltern oder Großeltern könnte zur Folge haben, dass sich die Verzagtheit in Luft auflöst. Denn im Vergleich mit den Erlebnissen früherer Generationen ist das heutige Dasein für die meisten Deutschen ein Paradies.
Die Narben bleiben
Der Blick zurück wird oft verstellt von den Figuren, die Geschichte machten. Deshalb fallen den meisten Menschen zum Nationalsozialismus erst mal Namen wie Hitler oder Goebbels ein. Aber es waren schon immer die kleinen Leute, auf deren Kosten sich diese Geschichte ereignet hat. Die Wunden mögen verheilt sein, doch die Narben bleiben, sichtbar oder unsichtbar.
Der Historiker Konrad H. Jarausch hat 80 ganz normale Deutsche – Ost- und Westdeutsche, Frauen und Männer, Täter und Opfer – gebeten, ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Viele von ihnen haben sehr lebendige Erinnerungen an jene Jahre, und seien es Erinnerungen aus zweiter Hand, also aus den Erzählungen ihrer Eltern.
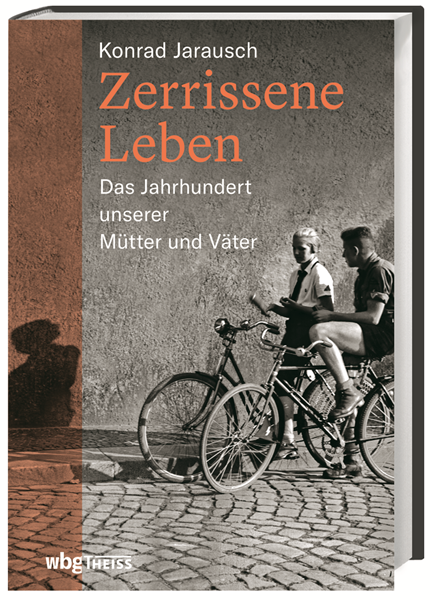
Meist stammten die Schilderungen über Bombennächte und Evakuierung von den Müttern; die Väter haben lieber geschwiegen. Das gilt auch für die überlebenden Opfer der Judenverfolgung. In vielen jüdischen Familien ist der Holocaust ein allenfalls abstraktes Thema: Oft haben die Mitglieder der Enkel-Generation erst durch Zufall erfahren, dass Großvater oder Großmutter wie durch ein Wunder ein Konzentrationslager überlebt haben.
Ebenfalls ein Tabu war jahrzehntelang die Darstellung des deutschen Volks als Leidtragende des Krieges. Angesichts des namenlosen Grauens in den Konzentrationslagern oder den Gräueltaten der Wehrmacht beim Rückzug aus Osteuropa verbot es sich von selbst, die Opferzahlen gegeneinander aufzurechnen. Hatten die dummen Kälber – frei nach Bertolt Brecht – ihre Metzger nicht selber gewählt?
Die meisten Menschen sind unpolitisch
Die meisten Menschen waren damals wie heute eher unpolitisch. Nur wenige Mütter werden ihre Söhne gern in den Krieg geschickt haben. Als dieser Krieg dann die Heimat erreichte, brachte er eine Verwüstung ungeahnten Ausmaßes mit sich. Jeder kennt die Bilder aus dem Fernsehen, aber niemand kann sich den Schock vorstellen, wenn man zwar die Nacht im Luftschutzbunker überlebt hat, aber im Morgengrauen erkennen muss, dass nahezu die gesamte Stadt in Schutt und Asche liegt.
Kein Wunder, dass die Erfahrungen jener Jahre zur Folge hatten, dass Biografien regelrecht zerfetzt wurden. Als der Krieg nach Deutschland kam, forderte er seine Opfer vor allem unter Frauen und Kindern. Allein eine halbe Million hat die Flucht aus Ostpreußen, Pommern oder Schlesien nicht überlebt. Viele Familien verloren bei den Bombardierungen ihr komplettes Hab und Gut, ein Großteil der rund 800.000 Bombenopfer waren Frauen. Zwei Millionen Frauen, vom Mädchen bis zur Greisin, wurden von den Soldaten der Roten Armee vergewaltigt. Umso unverständlicher, dass es ein rechter Politiker wagt, diese Zeit als „Vogelschiss“ innerhalb der ansonsten erfolgreichen deutschen Geschichte zu bezeichnen.
Die große Zerstörung
Das Kriegsgrauen endete mit der Kapitulation im Frühjahr 1945 oder zumindest kurz darauf – die Bedrohung für Leib und Leben jedoch nicht. In den Erzählungen der Eltern oder Großeltern fällt in der Regel nun der Satz: „Es gab ja nichts mehr.“ Produktionsstätten und Felder waren zerstört. Wer den Bombenhagel überlebt hatte, drohte zu verhungern oder zu erfrieren: Der Winter 1946/47 war der härteste seit Menschengedenken. Hinzu kam der knappe Wohnraum. Die Menschen mussten zusammenrücken, zumal bis zu 14 Millionen Flüchtlinge aus den früheren Ostgebieten des untergegangenen Deutschen Reichs integriert werden mussten.
Und dann war da noch das Trauma der Niederlage. Die Jungen, die sich noch wenige Jahren zuvor für ein Leben in Uniform begeisterten, und die Mädchen, die für den „Führer“ schwärmten, hatten nicht nur viel zu früh erwachsen werden müssen – erst nach dem Krieg wurde ihnen klar, dass sie nicht nur ihrer Jugend beraubt, sondern auch systematisch betrogen worden waren. Alles, woran sie geglaubt hatten, war nichts mehr wert. Kein Wunder, dass die Generation Hitlerjugend und Bund deutscher Mädel lieber nach vorn schaute und sich daran machte, die Städte aufzubauen – es sollten Jahrzehnte vergehen, bis das Land reif genug war, um sich seiner Vergangenheit zu stellen.
Wenig Zeit zum Erzählen
Alle, die den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebt haben, sind sich einig, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Die Angehörigen jener Jahrgänge sind mittlerweile teilweise weit in den Achtzigern. Sie werden nicht mehr lange Zeit haben, ihre Kindheitserlebnisse weiterzugeben. Deshalb ist die Arbeit von Konrad H. Jarausch, die sich in seinem Buch „Zerrissene Leben. Das Jahrhundert unserer Mütter und Väter“ nachlesen lässt, gar nicht hoch genug zu bewerten. Dank einer klugen Strukturierung wird aus den autobiografischen Schilderungen das spannend zu lesende Mosaik eines kollektiven Gedächtnisses, gewürzt mit Sätzen wie diesem: „Wild und turbulent, alles vernichtend, wie die Woge des Meeres, ist die Zeit über uns hinweggegangen.“





