Frau Reski, lassen Sie uns über Venedig reden. Wie ist die Situation aktuell?
Das Virus ist der Super-Gau, der im lukrativen venezianischen Tourismuskonzept nicht vorgesehen war. Venedigs Kartoffelkäfer. Die touristische Monokultur, der in Venedig seit 30 Jahren wie einer Staatsreligion gehuldigt wird, wird zum ersten Mal infrage gestellt – und wir hoffen, dass das Venedig des Nach-Corona nicht übergangslos an das des Vor-Corona anschließt. Allerdings kam vonseiten der Verantwortlichen bisher kein Vorschlag, Alternativen zu dieser Monokultur zu entwickeln.
Sie wohnen in San Marco und waren im letzten Frühjahr eine der wenigen Menschen, die den Markusplatz überqueren durften. Wie haben Sie das erlebt?
Im Lockdown wirkte die Stadt, als hatte jemand bei dem in Endlosschleife laufenden Venedigfilm auf die Stopptaste gedruckt. Es war unwirklich, beängstigend und schön zugleich.
Leben in Venedig heißt „Venedig beim Sterben zuzuschauen“, so schreiben Sie. Jetzt haben Sie ein Buch darüber publiziert. Warum?
Ich habe kein Buch über das Sterben, sondern über das Leben in Venedig geschrieben. Ich bekämpfe die Klischees, die über Venedig verbreitet werden, weil sie todbringend sind. Venedig wird immer nur benutzt – mal als Verkaufsargument für aus dem Internet zusammengestoppelte Venedig-Krimis, mal als unique selling point für Kreuzfahrtgesellschaften. Venedig ist aber mehr als eine „Marke“. Es ist eine Stadt, die um ihr Überleben kämpft. Auf die verbliebenen 51.000 Einwohner kamen zuletzt 30 Millionen Touristen pro Jahr. Da bleibt vom venezianischen Leben nicht mehr viel übrig.
Sie sind mit der Schriftstellerin Donna Leon und dem Schauspieler Ulrich Tukur befreundet, die beide entnervt weggezogen sind. Könnten Sie sich das auch vorstellen?
Nein, das ist undenkbar, der Venezianer an meiner Seite wird krank, wenn er aus dem Fenster blickt und kein Wasser sieht.
Sie beschreiben ein Venedig der Fassaden: die Palazzi verschachert an internationale Konzerne, entkernt und entseelt. Dahinter Hotels oder unterkühlte Einkaufspassagen. Wer trägt Schuld am Dilemma?
Venedig ist kein Opfer einer Naturgewalt, sondern konkreter politischer Entscheidungen. Die Stadt wurde auf dem Altar des Marktes geopfert. Leider können wir Venezianer nicht über unseren Bürgermeister bestimmen, weil Venedig im Faschismus mit dem Festland zwangsverheiratet wurde – wo heute die Mehrheit der Wähler lebt. Sie leiden nicht unter den Auswirkungen des Massentourismus, sondern profitieren davon – und wählen denjenigen, der ihnen das garantiert.

Die Basis des Niedergangs wurde zementiert, als Venedig mit Mestre und Marghera zu „Groß-Venedig“ zusammengelegt wurde. Seither können Reiseveranstalter schäbige Hotels in Mestre als „Venedig-Festland“ verhökern. Lassen sich Touristen so leicht blenden?
„Sie töten Venedig, um die Reliquien als Ikonen des Festlands zu verkaufen“, stellte eine venezianische Historikerin dazu treffend fest – eine Erfahrung, die auch zwei Japanerinnen machen mussten, die glaubten, ein Hotelzimmer in Venedig gebucht zu haben, in Mestre in einem der Plattenbauhotels aufwachten und bei ihrer Reklamation erfuhren, dass alles korrekt abgelaufen war.
Auch in anderen begehrten Städten paktieren Bürgermeister mit Investoren und begnügen sich mit leeren Versprechungen. Natur und Kulturgüter werden zerstört, Wohnraum immer teurer. Was ist in Venedig anders?
Venedig leidet nicht wie andere Städte an der Gentrifizierung, sondern am Overtourism. Hier ist es nicht so, dass die ärmeren Schichten durch wohlhabendere ersetzt worden wären, in Venedig werden die Einwohner ausschließlich durch Touristen ersetzt.
Wieso sind die Bürgerinitiativen so machtlos? Als Beispiel führen Sie den Kampf um Poveglia an, eine der letzten Laguneninseln, die noch keinem Investor zum Opfer fiel.
Gerade diese Bürgerinitiative war keineswegs machtlos: Sie hat dank eines erfolgreichen Crowdfundings vorerst vereitelt, dass Poveglia dem Bürgermeister, einem Milliardär, verkauft wird. Wir venezianischen Bürger sind der Sand im Getriebe.
Sehr gelacht habe ich bei der Beschreibung Ihres Sturzes in den Canal Grande – wie ein Zuschauer im Zirkus, der den purzelnden Clown beobachtet. Wieso ergötzen wir uns am Missgeschick von anderen?
Ich hätte auch gelacht, wenn ich gesehen hätte, wie eine Frau im pinkfarbenen Kleid in den Canal Grande fällt und dann wie ein toter Walfisch an Bord gezogen wird.
Todtraurig ist hingegen der Umzug von Alberto, dem Fischer, nach Mestre. Wieder ein Venezianer verloren. Wie ließe sich das umkehren?
Indem Venedig bei der Europäischen Union einen Spezialstatus beantragt, der der Stadt aufgrund der Insellage zustunde, nicht aber, solange Venedig zusammen mit dem Festland regiert wird. Die einzige Lösung: Venedig muss autonom werden, um über sein Schicksal selbst bestimmen zu können.
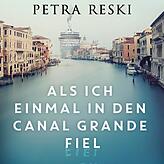
400 Gondoliere gibt es in der Stadt, Ihre Freunde scheinen sie nicht zu sein.
Die Gondolieri sind eine einflussreiche, mit allen venezianischen Wassern gewaschene Kaste. Und ein Kulturgut noch dazu, wie heilige Kühe in Indien. Glücklicherweise gibt es unter ihnen auch noch einige, die nicht nur das Geld, sondern auch Venedig lieben.
Der Venezianer an Ihrer Seite, Venezianer Doc, wie Sie ihn nennen, scheint stoischer zu sein als Sie: Fatalismus oder eine kluge Art, die Nerven zu schonen?
Er ist diplomatischer als ich. Leben und leben lassen ist eine der Basisregeln des Zusammenlebens in einer kleinen Stadt wie Venedig.






