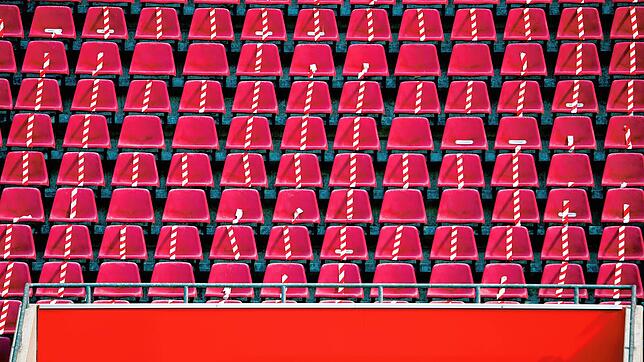Der Fußball und ich, wir kennen uns schon lange, unser einst so inniges Verhältnis begann schon in Grundschul-Zeiten. Beim Autogrammesammeln, wenn mal wieder einer der großen Vereine in meine mittelbadische Heimat kam, um bei irgendeinem Dorfverein zweistellig zu gewinnen. Damals sprachen HSV-Spieler noch norddeutsch, die vom KSC hingegen badisch. Dass das heute nicht mehr so ist, ist mir völlig egal, arrogante Spieler gab es unabhängig vom Dialekt damals auch schon zuhauf. Auch die Behauptung, dass es im Fußball „nur noch um Geld geht“, lockt mich nicht hinterm Ofen hervor. Das war damals auch schon so.
Goldene Steaks gab es zwar noch nicht, dumme Spieler aber schon, die sogar stolz darauf zu sein schienen, dass sie gerade ihren Porsche gegen einen Baum gefahren hatten. Auch das Gerede von den „Werten“ und der „Vorbildfunktion“ des Fußballs habe ich schon immer für eine alberne Schutzbehauptung gehalten. Ich glaube also, von mir sagen zu können, dass ich den Fußball nie überhöht habe.
Und doch ist in den vergangenen Jahren zu viel vorgefallen zwischen dem Fußball und mir, als dass ich mir noch unbefangen ein Bundesligaspiel anschauen könnte. „Kommerzialisierung“ ist ein großes Wort, und es ist ziemlich abstrakt. Konkret äußert sie sich so: 200 Euro, um mit den Kindern ein Spiel gegen Augsburg sehen zu können, 90 Euro fürs Fantrikot, fünf für die Cola. Und fünf Millionen für den Ersatzspieler.
Fünf Decoder, um Fußball im Fernsehen anschauen zu können. Rund um die Uhr natürlich, denn ein Spieltag streckt sich heute auf vier Tage. Viel Lärm um nichts, denn eigentlich ist die ganze laut beworbene Angelegenheit stinklangweilig: Die Topclubs haben den 20-fachen Etat der „Kleinen“ in der Liga. Und trotzdem wird allerorten so getan, als würden jeden Sommer die Karten neu gemischt.
Erinnert mich an den Cartoon mit dem Lehrer, der einem Affen und einem Elefant die Prüfung abnimmt: „Im Sinne eines fairen Wettbewerbes kriegt ihr dieselbe Aufgabe: Klettert auf diesen Baum!“ Welch Wunder: Meister werden immer die Bayern.

Ich gebe es zu, ich kriege manchmal schlechte Laune, wenn ich an den Profifußball denke. Und ich kann ziemlich genau sagen, ab wann meine kritische Distanz zur Maximaldistanz wurde. Das war während Corona, als er sich aufgeführt hat wie Marie-Antoinette. Kuchen wollte er essen, jeden Tag und ohne Pause. Und es war ihm völlig egal, was für den Rest auf der Speisekarte stand. Er wollte unbedingt weiterspielen, auch ohne Fans, die ja Ausgangssperre hatten – und andere Sorgen. Zumindest dann, wenn sie Angehörige auf der Intensivstation hatten oder nicht wussten, wer jetzt die Kinder betreuen soll, deren Kita schließen musste.
Aber, es stimmt ja, der Profizirkus musste auch wirklich weiterspielen. Denn wenn der Spielbetrieb geruht hätte, wären die meisten Vereine in ein paar Wochen pleite gewesen. Ganz einfach, weil sie keine Fernsehgelder mehr bekommen hätten, mit denen sie die absurd hohen Spielergehälter gegenfinanzieren hätten können.
Die Corona-Extrawurst
Aber oh, weh, ich vereinfache. Der Fußball habe sich ja der Debatte gestellt, hieß es. Und das mit der gesellschaftlichen Verantwortung hätten natürlich auch die Spieler verstanden. So war es allerorten zu hören. Weshalb sie oft sogar einem Gehaltsverzicht von 5 bis 15 Prozent zugestimmt hätten. Fürwahr ein existenzieller Einschnitt bei den branchenüblichen Gehältern, aber natürlich sickerte durch, dass der Gehaltsverzicht bei den meisten Vereinen eine Gehaltsstundung war, die fehlenden Hunderttausende sind also längst wieder auf dem Konto der Spieler.
Naja, immerhin eine Stellungnahme gab es, die man als Hoffnungsschimmer interpretieren konnte. Verfasst hat sie der Mannschaftsrat einer Bundesliga-Mannschaft, um zu erklären, warum zwar die über zwei Millionen Freizeitkicker die Corona-Regeln beachten sollten und die Schulen geschlossen bleiben sollen, warum es aber ausgerechnet im Profifußball nun mal übergeordnete Gründe gebe, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
„Meine Mitspieler und ich sind besorgt um unser Land und auch unsere Branche“, las man. „Also reduzieren wir für mindestens die nächsten drei Monate unser Gehalt auf das eines Krankenpflegers, des wahren Leistungsträgers unserer Gesellschaft. Wir wollen zwar bald wieder spielen, damit unser Verein, aber auch der gesamte deutsche Fußball überleben und die Leute ein bisschen Abwechslung haben. Außerdem fehlt uns das Fußballspielen so sehr. Aber weil wir wissen, dass unser Job nicht nur, aber vor allem in Corona-Zeiten einem Privileg gleichkommt, wollen wir eine Gegenleistung erbringen. Und wir geben gern, weil wir sehr viel haben.“
Sind Ihnen jetzt auch gerade Tränen der Rührung gekommen? Sie können sie wieder abwischen, denn natürlich stammt das Schreiben nicht aus der Branche, sondern von meinem „Zeit“-Kollegen Oliver Fritsch, der mal laut darüber nachgedacht hat, wie die Kicker-Zunft in der Corona-Pandemie auch hätte argumentieren können.

Wobei, dass der Fußball durchgekommen ist mit seiner Heuchelei, das darf man ihm eigentlich gar nicht verübeln. Jeder ist sich selbst der Nächste, das lernt bei uns jedes Kind schon früh. Auch dass die Branche Millionen scheffelt und sich vom Steuerzahler ihre Stadien, Anfahrtswege und Polizeieinsätze finanzieren lässt, muss man eher der Politik übelnehmen, die ihr das ermöglicht. Kennt noch jemand den einstigen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans? Der hat mal in einem hellen Moment erklärt, warum das alles so läuft: „Die großen, namhaften Bundesligavereine haben immer den Staat auf ihrer Seite. Wenn es um Fußball geht, tun sich alle Parlamentarier schwer, klare Kante zu zeigen. Beim Fußball gibt es keine Parteigrenzen.“ Ach, wie schön.
Es ist, wie es ist. Der Profifußball ist mir gleichgültig geworden. Privat gehe ich eh schon seit Jahren lieber in die Regional- oder Oberliga, wenn ich Fußball schauen will. Da kommt die Wurst manchmal noch vom Metzger vor Ort. Und es gibt – echt abgefahren – noch Eckbälle, die nicht vorher in unglaublichen Dezibelzahlen vom Baumarkt „präsentiert“ werden. Und was das Schönste ist: Es gibt keinen Videobeweis, diese Erfindung aus der Hölle. Tor ist Tor. Und Grund für spontanen Ärger. Oder spontane Freude. Aber selbst die gönnt uns die erste Liga nicht mehr.
Während 57 Experten in 58 Videoauflösungen herauszufinden versuchen, ob 59 Sekunden vor dem vermeintlichen Tor auf Höhe der Mittellinie ein Foul vorlag, ergründen andere, ob der Flankengeber beim vorletzten Pass nicht vielleicht doch mit dem linken Schnürsenkel im Abseits stand. Für den Zuschauer vorm Fernseher mag eine solch skrupulöse Wahrheitsfindung eine praktische Sache sein.
Man kann in der Zeit schließlich auf Toilette gehen, ein neues Bier holen und bei der Mutter anrufen, wie es ihr so geht und kommt immer noch rechtzeitig zur Entscheidungsfindung zurück. Der Stadionbesucher hat hingegen in der Zwischenzeit komplett die Nerven verloren. Aber um den geht es ja schon lange nicht mehr.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es angesichts des Klimawandels so clever ist, die Atomkraftwerke stillzulegen. Aber den Profifußball, den sollte man ganz sicher stilllegen. Damit er endlich einmal aufhört, nur um sich selbst zu kreisen. Ab aufs Zimmer, ein bisschen über sich und das normale Leben nachdenken. Und wenn ihm etwas aufgefallen ist, kommt er wieder runter. Und dann versuchen wir es vielleicht noch mal von neuem.