Eigentlich hätte die Geschichte ja auch so ausgehen können. Im 21. Jahrhundert spielt Identität in der Politik keine Rolle mehr. Nicht, weil Menschen keine Identitäten mehr hätten. Das wäre absurd. Sondern weil sie gelernt haben, dass Identitäten einfach zu instrumentalisieren und gegeneinander auszuspielen sind.
Deshalb verzichtet man im Politischen auf Identitätsargumente, ist allgemein zurückhaltend mit Verweisen auf Herkunft, Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung. Man weiß zwar, wie und wer man ist. Und idealerweise auch, warum man ist, wie und wer man ist. Aber man trägt die Identität nicht wie eine Monstranz vor sich her. Nicht zuletzt, weil man Systemwechsel fürchtet – was, wenn es dereinst ein autoritäres Regime umso leichter hätte, mich zu identifizieren?
Gekommen ist dann alles ein wenig anders. Nun ja: eigentlich ganz anders. Identität ist die Kategorie der Stunde.
Ob in Politik, Wirtschaft, Medien, Bildung – kaum ein Bereich, dessen Fragen sich nicht in Identitätsfragen verwandelt hätten: Wäre dieser Forscher da zum selben Ergebnis gekommen, wenn er eine Frau wäre? Würde diese Kandidatin da den Posten erhalten, wenn sie keine Frau wäre? Ist diese Person da nur so weit gekommen, weil ihre Hautfarbe passt? Und ist dieser Person da der Weg nach oben verstellt, weil sie die falsche sexuelle Orientierung hat?
Identität als Volkssport
In den sozialen Netzwerken ist Identitätsinszenierung zum Volkssport geworden. Der Soziologe Andreas Reckwitz beobachtet, in der „Gesellschaft der Singularitäten“ performe man das „besondere Selbst vor den Anderen, die zum Publikum werden.“ In Twitter-Profilen listen Nutzer ihre Identitätsmerkmale, als deklarierten sie die Inhaltsstoffe eines Lebensmittels. Gleichzeitig unternehmen Regierungen wie auch Unternehmen gewaltige Anstrengungen, Bürger und Kunden permanent zu identifizieren.
Neben Geheim- sind Offensichtlichkeitsdienste getreten. Wer da nicht verortbar, klassifizierbar, kategorisierbar ist, macht sich verdächtig.

Auch im US-amerikanisch geprägten, linken Aktivismus gilt: Weiße, die sich nicht als „weiß“ identifizieren lassen wollen, hängen automatisch einem trügerischen Universalismus an und klammern sich an unverdiente Privilegien. Für Rechtsradikale wiederum ist völkische Identität alles, die Identität eigensinniger Einzelner nichts. Kurz gesagt, ist Identität ein Paradigma, an dem niemand vorbei kommt. Alle genannten Identitätsverständnisse beeinflussen sich in ihrer Verschiedenheit wechselseitig.
Aktivistische Kategorie
Dabei fristete der Begriff „Identität“ lange ein Schattendasein. Mit den sozialpsychologischen Forschungen von Erik H. Erikson und Henri Tajfel gewann er in den 1950er und 60er Jahren an Bedeutung. Doch erst die postmoderne Identitätspolitik hat „Identität“ zu jener aktivistischen Kategorie gemacht, als die sie uns derzeit meistens begegnet. Gemeint ist nicht die liberale individuelle Identität oder die rechte völkische Identität, sondern die Gruppenidentität von Minderheiten, auf welche die Neue Linke in der Nachkriegszeit zu fokussieren begann.
1977 publizierte eine Gruppe schwarzer, lesbischer Frauen in Boston, Massachusetts, einen Text, der heute als Schlüsseldokument postmoderner Identitätspolitik gilt. Im Combahee River Collective Statement argumentierten die Autorinnen, dass ihre besondere Situation ausgeblendet werde. Schwarz, weiblich, homosexuell – geboren war die Diagnose „Mehrfachdiskriminierung“ aufgrund von der Norm abweichender Identität.
Das Combahee River Collective Statement zeigt, dass Identitätspolitik nicht auf dem Willen zu einer besonderen Identität beruhen muss, sondern sich aus unfreiwilliger Differenzerfahrung speisen kann. Bestimmte Identitäten werden von Anderen überhaupt erst zu etwas Besonderem gemacht. Hätte man afroamerikanische, homosexuelle Frauen im Alltag, in der Politik und im Recht gleich behandelt wie andere Gruppen, wäre Identitätspolitik wohl nie entstanden.
Grundlage für gerechte Politik
Deshalb trifft der Vorwurf, Identitätspolitik würde die Gesellschaft spalten, nur bedingt zu. Identitätspolitik entsteht auch dort, wo die Gesellschaft gespalten wird. Oft ist sie Effekt, nicht Ursache. Dass sie heute von diversen Gruppen in spalterischer Absicht instrumentalisiert wird, steht dazu nicht im Widerspruch.
Anstatt über Identitätspolitik zu polemisieren, gilt es deshalb, ihre Potenziale ernst zu nehmen. Im besten Fall kann sie helfen, das Konkrete und Spezifische zu erkennen, anstatt sich in nebulösen universalistischen Sonntagsreden zu ergehen – genau darum dreht sich auch das Combahee River Collective Statement. Darin wird übrigens gar politische Korrektheit, Sexismus von Schwarzen gegen Schwarze und Rassismus von selbsternannten Progressiven kritisiert. Eine solche Identitätspolitik liefert die Grundlage für gerechte Politik.
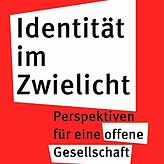
Wo Identitätspolitik aber nicht analytisch, sondern ideologisch ist; wo sie Menschen aufs Neue in Identitätskasernen sperrt und Einzelne ohne deren Einverständnis mit Gruppen gleichsetzt, da ist Widerspruch angesagt. Theodor Heuss schrieb 1949 überzeugend: „Wir dürfen nicht immer sagen: Er ist ein Franzose – also; er ist ein Engländer – also; er ist ein Deutscher – also; er ist ein Jude – also. Nein, so geht es nicht. Wir müssen im Verhältnis Mensch zu Mensch eine freie Bewertung des Menschentums zurückgewinnen.“
Empathie statt Zynismus
Vor diesem Hintergrund muss es in den kommenden Jahren um eines gehen: schonungslose Differenzierungsarbeit. An billig zu habenden Meinungsbekundungen und zynischem Kulturkampf besteht derzeit kein Mangel. Wohl aber an Nüchternheit, Gerechtigkeit, Sachlichkeit, Empathie, Präzision.
Wenn Identitätspolitik konstruktiv sein soll, muss sie analytisch werden. Wo also kämpfen Gruppen, denen ihr Leben bislang erschwert worden ist, aus guten Gründen um Respekt? Und wo werden diffuse Empfindungen zu „struktureller Ausgrenzung“ hochstilisiert? Wo befeuern Rechtsradikale mit Strohmann-Vorwürfen die Identitätsdebatten, um solange Misstrauen zu schüren, bis der Ruf nach Reinheit, Härte und Autorität erschallt? Und wo instrumentalisieren sie Linksradikale, um die verhasste „Mehrheitsgesellschaft“ zu beschämen? Wo schlachten Medien mit reißerischen Überschriften Identitätspolitik aus, um Klicks zu generieren? Und wo widmen sie sich dem Thema auf sachliche Weise?
Richtig verstanden, kann Identitätspolitik dazu beitragen, diese Fragen zu beantworten, schult sie doch den Blick für das Spezifische und Konkrete. Dafür darf der Umgang mit ihr eines nicht sein – identitär, das heißt klientelistisch, tribalistisch, ausgrenzend.






