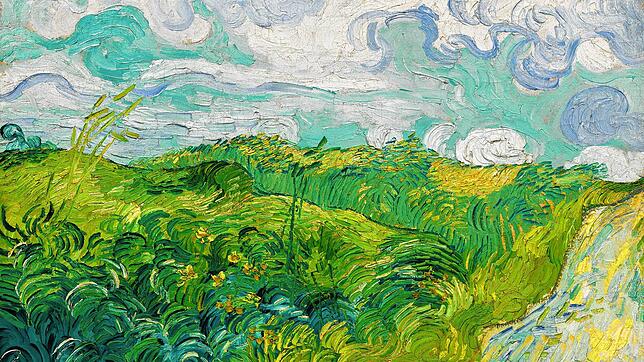Alles wird wieder grün in diesem Frühling, die Natur, die Landespolitik – und natürlich auch die Sprache. Die freilich hat ihre rätselhaften Seiten. Beim Ausflug ins Grüne ist die Wortherkunft noch leicht zu entschlüsseln. Was aber lässt uns „nicht mehr grün sein“? Und was genau ist ein „Grünschnabel“?
Die Antworten sind oft erstaunlich schwer zu finden. Selbst der Dudenverlag kapituliert: Sein jüngst erschienenes „Buch zur Farbe“ liefert für viele Begriffe nur spärliche Informationen. Doch es gibt ja noch andere Quellen.
- Grüner Zweig: Wer auf diesen nicht kommt, hat ein Problem. Das liegt daran, dass nur aus einem grünen Zweig auch einmal ein dicker, brauner Ast werden kann. Der grüne Zweig als Symbol kommenden Erfolgs findet sich bereits in der Bibel. So heißt es in der Lutherbibel (Buch Hiob) über den Frevler: „Er wird ein Ende nehmen vor der Zeit, und sein Zweig wird nicht grünen.“
- Jemandem nicht grün sein: Grün ist also das, was noch Aussichten auf gedeihliches Wachstum hat. Fehlt es, wächst auch nichts, schon gar keine Sympathie.
- Greenhorn: Haben wir das mit dem grünen Zweig einmal verstanden, ist es auch zum Greenhorn, also dem grünen Horn, nicht mehr weit. In Deutschland begegnet uns dieser Begriff erstmals bei Karl May. Der führt ihn zwar in „Winnetou“ auf ein „Fühlhorn“ zurück, doch das ist sprachhistorisch fragwürdig. Realistischer erscheint das Ergebnis einer Recherche, die bereits vor längerer Zeit die New York Times veröffentlicht hat. Demnach galt „Grün“ im 17. Jahrhundert als Synonym für „Jung“ und bezog sich auf die noch jungen Hörner heranwachsender Rinder. So unerfahren wie diese kamen alteingessenenen Amerikanern viele neue Einwanderer vor.
- Grünschnabel: Und jetzt der Brückenschlag zum Grünschnabel. Wie bei den Rindern galt auch hier „grün“ als Synonym für „jung“. Und doch war lange Zeit gleichzeitig das Wort „Gelbschnabel“ gebräuchlich. Zum Beispiel in Goethes „Faust“: „Wenn man der Jugend reine Wahrheit sagt, die gelben Schnäbeln keineswegs behagt.“ Das ist schon allein deshalb logisch, weil junge Vögel tatsächlich gelblich gefärbte Schnäbel tragen. Irgendwann im 20. Jahrhundert geriet die Gelb-Variante allerdings in Vergessenheit: Vielleicht war daran ja Karl Mays Greenhorn schuld.
- Grüne Neune: Jetzt wird es abenteuerlich. Für den Ausruf „Ach, du grüne Neune!“ gibt es nämlich gleich einen ganzen Haufen möglicher Erklärungen. Da wäre zum einen das am „Grünen Weg“ gelegene Berliner Tanzlokal mit der Hausnummer 9: ein „Etablissement von zweifelhaftem Ruf“, wie es im „Buch der Farben“ heißt. Möglich ist aber auch, dass sich die Redewendung der Kunst des Kartenlegens verdankt. Die Pik-Neun galt dabei als böses Omen, und Pik wurde im deutschen Spiel meist „Laub“, „Blatt“ oder auch „Grün“ genannt. Und nicht zuletzt wäre da noch das Kegeln. Sprachwissenschaftlerin Christiane Wanzeck gibt sich in ihrer Untersuchung zu „lexikalisierten Farbwortverbindungen“ überzeugt: Es handelt sich um eine Variante des Ausrufs „Alle neune!“. Dafür spreche, dass „Ach, du grüne Neune!“ eine Äußerung des Erstaunens ist, ganz ähnlich wie „Alle neune!“ beim Kegeln. Allerdings ist das Erstaunen hier natürlich im negativen Sinn zu verstehen: „Grün“ als Synonym für „ärgerlich“ lässt daran keinen Zweifel aufkommen.
- Dasselbe in Grün: Kommt ein Dienstmädchen zum Kaufmann und reicht ihm ein Stück rosarotes Band. „Nochmal dieselbe Farbe, bitte!“, sagt sie: „Nur diesmal in Grün!“ Um 1800 war diese Pointe ein Partykracher, sogar die Mutter des Philosophen Arthur Shopenhauer erwähnte sie. Heute lebt sie in der Redewendung „Dasselbe in Grün“ fort. Jedenfalls glauben das die meisten Sprachhistoriker. Weniger wahrscheinlich hingegen ist, dass eine 1903 erschienene Karikatur Pate stand: Auf der ist ein reicher Bahnkunde zu sehen, der dieselbe Fahrkarte wie sein ärmlicher Nachbar erwerben möchte – nur in Grün. So nämlich war die Farbe der teureren zweiten Klasse. Wieder andere Versionen stellen Bezüge zum Billardspiel oder einem 1924 gefertigten Opelmodell her (weitgehend identisch mit einem Konkurrenzprodukt, nur in Grün statt Gelb): Was wirklich stimmt, werden wir auch hier wohl nie erfahren.
- Im grünen Bereich: Wenn wir „grünes Licht geben“, die „grüne Welle“ nutzen und uns überhaupt „im grünen Bereich“ bewegen, dann hat sich die Farbe Grün längst aus der Natur verabschiedet und den Bereich des Technischen betreten. Wo es grün leuchtet, da haben wir ganz allgemein freie Fahrt – jedenfalls seit Erfindung der Ampel. Und dass dem so ist, verdankt sich der optischen Wirkungskraft: Auf Grün und Rot reagiert das Auge am Schnellsten.
„Grün – das Buch zur Farbe“: Dudenverlag 2021; 208 Seiten, 22 Euro.