Was ist denn eigentlich mit Katja Ebstein? Frank-Walter Steinmeier hat ihr doch neulich noch so schön geschrieben. Der Bundespräsident gratulierte der Sängerin am 9. März zu ihrem 80. Geburtstag. In seinem Brief bezeichnete Steinmeier die in einem Dorf in Oberbayern lebende Ebstein als „wahre Ikone des deutschen Schlagers“ und betonte in seiner Sammlung warmer Worte insbesondere ihre „prägenden Eurovisions-Auftritte“. Das kann man stehen lassen.
Katja Ebstein ist Deutschlands erfolgreichste Interpretin in der Geschichte des ESC. Gut, zu ihrer Zeit nannte man den Eurovision Song Contest in Deutschland noch beim feierlicheren französischen Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson, aber niemand außer der Folk-Pop-Schlager-Bardin schaffte es – bei drei Finalteilnahmen – gleich dreimal aufs Treppchen.

1970 kam Ebstein mit „Wunder gibt es immer wieder“ auf Platz drei, 1971 bereits wiederholte sie den Bronze-Rang mit „Diese Welt“ und 1980 kratzte sie mit „Theater“ gar am Gesamtsieg, am Ende wurde es Rang zwei hinter Johnny Logans „What‘s Another Year“. „Ihre Karriere ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Kunst und Musik auch in Zeiten des Wandels und der Herausforderungen Bestand haben können“, schreibt Steinmeier und gibt Ebstein – Was ist schon ein Jahr? – so die Steilvorlage für eine Teilnahme 2026.
Dass die politisch engagierte und sich für Demokratie und Mitmenschlichkeit einsetzende Trägerin des Bundesverdienstkreuzes bei ihrem bisher letzten Gesangswettbewerb Ende 2023 gleich in der ersten Runde rausflog, soll nicht überbewertet werden. Schließlich musste Ebstein in „The Masked Singer“ als Okapi antreten.
Im Medaillenspiegel im Mittelfeld
Rechnet man die 80-Jährige raus, so sieht Deutschlands Bilanz bei dem Wettbewerb weitaus mauer aus. Gäbe es so etwas wie einen offiziellen Medaillenspiegel, dann würde die Bundesrepublik irgendwo im Mittelfeld herumdümpeln.
Egal, wen man in der guten, alten Nachkriegszeit auch schickt, und meistens sind es gut gelaunte Sängerinnen wie Margot Hielscher, Alice und Ellen Kessler, Lale Andersen, Conny Froboess („Zwei kleine Italiener“ kam 1962 immerhin auf Platz sechs), Wencke Myhre, Siw Malmkvist, Mary Roos, Gitte oder Ireen Sheer – den Sieg holen stets andere Nationen.

Bis 1982. Nicole, 17 Jahre, weiße Gitarre, die sprichwörtliche Unschuld vom (Saar)Lande, gewinnt mit ihrer sehnsuchtsvollen Lagerfeuer-Hymne „Ein bisschen Frieden“. Das kleine Lied, das sogar in Großbritannien als „A Little Peace“ die Spitze der Charts erreicht, passt perfekt in eine Zeit der Aufrüstung, der Angst vor einem Atomkrieg mit Russland und dem Aufkommen der Friedensbewegung in ganz Europa. Dass Deutschland 2025 mit einem Song antritt, der „Baller“ heißt, mag in diesem Zusammenhang Zufall sein.
Der Sieg von Nicole ist zugleich der Triumph des selbstbewussten Komponisten-Teams Ralph Siegel (Musik) und Bernd Meinunger (Text). Die beiden dominieren das 1980er-Eurovisions-Deutschland. „Dschingis Khan“ von Dschingis Khan (1979, Platz vier), Ebsteins „Theater“, „Johnny Blue“ von Lena Valaitis (zweiter Rang, 1981), die gleich drei Beiträge der zusammengewürfelten Feel-Good-Truppe Wind (wobei die Musik von „Für alle“, 1985 Zweiter, nicht von Siegel, sondern von der Sängerin Hanne Haller stammt).
In den 90ern beginnt die große Krise
Dann jedoch plötzlich: die erste richtig große deutsche ESC-Krise. Das Duo Stone & Stone 1995: letzter Platz mit einem kümmerlichen Pünktchen für „Verliebt in dich“. Im Jahr darauf kommt es noch dicker. Der junge Sänger Leon bleibt mit „Blauer Planet“ schon in der Qualifikationsrunde hängen. 1996 wird das einzige Jahr, in dem Deutschland nicht im Finale dabei ist.
Da sich auch die anderen Großnationen mit allem Möglichen, aber selten mit Ruhm oder gar dem Sieg bekleckern, ändert man die Regeln. Seit 1997 sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien sowie seit 2011 auch Italien automatisch fürs Finale qualifiziert – schließlich sorgen sie mit ihren Rundfunkanstalten für die Finanzierung der kostspieligen Sause.
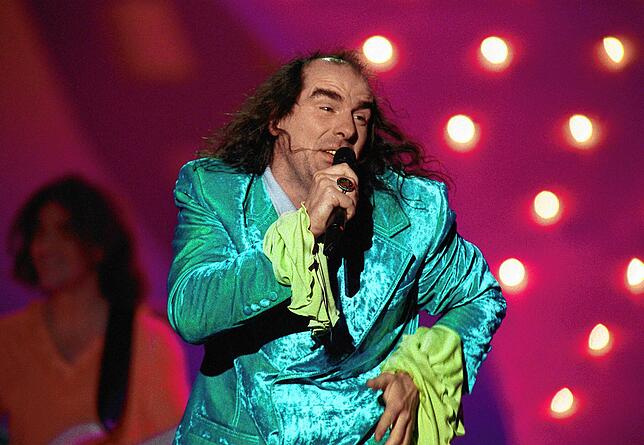
1998 kommt es zu einer echten Zäsur und zum Auftritt des damals noch jungen und unverbrauchten Stefan Raab. Der Entertainer, vom Ego einem Ralph Siegel mindestens ebenbürtig, übernimmt und schickt die knuddelige Kunstfigur Guildo Horn („Guildo hat euch lieb!“). Horn kommt auf einen guten Platz sieben, zwei Jahre später singt Raab selbst und wird mit „Wadde hadde dudde da?“ sogar Fünfter, 2004 entdeckt er den Schwarzwälder Max Mutzke, der mit „Can‘t Wait Until Tonight“ auf Rang acht ins Ziel kommt.
2010, nach ein paar erfolgsausbeuterisch durchwachsenen bis miesen Jahren (Gracia wird 2005 mit „Run & Hyde“ souverän Letzte, die No Angels, früher mal Topstars, 2008 Drittletzte), reißt Raab mit seiner Sendung „Unser Star für Oslo“ die gesamte Vorauswahl an sich – und findet tatsächlich ein Juwel. Lena Meyer-Landrut, damals noch Schülerin und ähnlich unschuldig wie 28 Jahre vorher Nicole, nur im schwarzen statt im gepunkteten Kleid, tritt mit dem sehr guten Popsong „Satellite“ an – und siegt haushoch. Ein Jahr später wird Lena mit „Taken By A Stranger“ noch mal Zehnte, 2012 Balladensänger Roman Lob („Standing Still“) Achter.

Als sich Raab zurückzieht, geht Deutschlands Erfolgsbilanz beim ESC den sprichwörtlichen Bach runter. Seit 2013 ist fast jedes Jahr Frust angesagt, ganz egal, wer ins Rennen geht. Ann Sophie 2015? Letzte. Jamie-Lee 2016? Letzte. Levina 2017? Vorletzte. S!sters 2019? Vorletzte. Jendrik 2021? Vorletzter. Malik Harris 2022? Letzter. Lord Of The Lost 2023? Letzte.
Egal, ob Metal, Schnulze oder Emo-Pop, egal, ob mit nationaler öffentlicher TV-Qualifikationsrunde oder ohne, jährlich wurden vom federführenden NDR immer wieder Nachwuchshoffnungen aus dem Hut gezaubert, die sich nicht im europäischen Wettbewerb zu behaupten wissen.
Einzige Ausreißer in den vergangenen zwölf Jahren sind Michael Schulte 2018 mit seinem traurig-gefühlvollen „You Let Me Walk Alone“ (Platz vier) und vergangenes Jahr der ebenso unprätentiöse wie sympathische Isaak, der mit „Always On The Run“ mit Mittelfeldplatz zwölf die Erwartungen zu übertreffen vermag.
Wie es nun in Basel wird? Raab ist wieder am Start, die Wiener Geschwister Abor & Tynna wirken überzeugend, der Electropop-Song „Baller“ ballert. Kann so oder so ausgehen. Kleiner Trost vorab für das bei den Buchmachern um Rang 20 herum eingestuften Duos: Ein enttäuschendes Abschneiden beim ESC muss nicht das Ende aller Erfolgsaussichten bedeuten.
Erinnern Sie sich an Texas Lightning?
Der Country-Song „No, No Never“ der Hamburger Band Texas Lightning um Sängerin Jane Comerford und Multiinstrumentalist Olli Dittrich erreichte 2006 in Athen beim Triumph der finnischen Heavy-Metal-Band Lordi einen wenig berauschenden 14. Platz.
In den folgenden Monaten aber entwickelte der quirlige Song ein äußerst munteres Eigenleben, erklomm den Spitzenplatz in den deutschen Single-Charts, hielt sich 38 Wochen in den Top 100 und wurde zum zweiterfolgreichsten Eurovisions-Song aller Zeiten – hinter „Puppet On A String“ von Sandy Shaw (1967) und vor Abba mit „Waterloo“ (1974).

Und auch Ann Sophie kann bezeugen, dass eine misslungene ESC-Erfahrung mitnichten das Ende der Karriere bedeuten muss. Ann-Sophie Dürmeyer, wie sie mit vollem Namen heißt, ist eine der vielseitigsten Musical-Darstellerinnen Deutschlands. Aktuell ist sie als Elsa in Disneys „Die Eiskönigin“ im Stuttgarter Stage Apollo Theater zu sehen.
Marianne Rosenberg, fast auf den Tag genau zehn Jahre jünger als Katja Ebstein, trat fünfmal in einem ESC-Vorentscheid an, viermal für Deutschland, einmal für Luxemburg. Ihre Bilanz ist desaströs. Für den Wettbewerb qualifizieren konnte sie sich nie. Aber „Er gehört zu mir“, das Lied, mit dem sie bei ihrem ersten Anlauf 1975 im deutschen Vorentscheid hängen blieb, ist zum Evergreen geworden. Ein Karaoke-Abend ohne den Kultklassiker mag vorstellbar sein – ist aber sinnlos.






