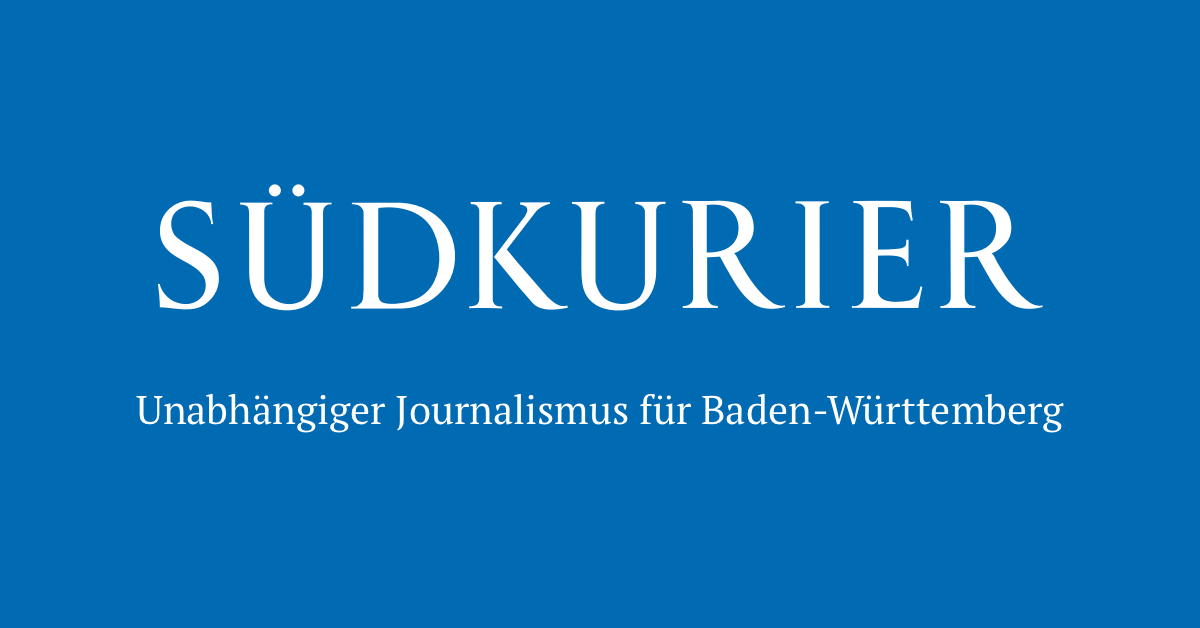Nur wenige Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt betreibt die Schweiz das älteste Kernkraftwerk der Welt: Beznau 1. Der 1969 in Betrieb genommene Reaktorblock und der zwei Jahre jüngere Block Beznau 2 stehen auf einer Insel im Fluss Aare, unweit der Einmündung in den Rhein. In unmittelbarer Nähe liegt auch der Kreis Waldshut in Baden-Württemberg – für die Bewohner des Kreises ist das „Technik-Museum“ Beznau eine ständige Quelle der Angst. „Im sogenannten Normalbetrieb gibt das Atomkraftwerk Beznau krebserzeugende Radioaktivität an die Umwelt ab“, warnt der Regionalverband südlicher Oberrhein der Umweltschutzorganisation BUND. „Ein schwerer Unfall oder Terroranschlag kann das Leben von hunderttausenden Menschen in Gefahr bringen und große Gebiete dauerhaft unbewohnbar machen.“ Neben Beznau stellten die Eidgenossen vor Jahrzehnten zwei weitere AKWs in der Nähe zu Deutschland auf: die Anlagen in Leibstadt und Gösgen.
Doch schon bald könnte sich die Furcht vor einer Katastrophe im Grenzgebiet etwas legen. Denn die Schweizer Bürger stimmen am kommenden Sonntag über den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie ab. Laut Umfragen dürfte der Ausgang knapp werden. Zwar hatte die Regierung bereits nach dem Megaunfall im japanischen AKW Fukushima das grundsätzliche Ende der umstrittenen Energiegewinnung beschlossen – doch Grüne und andere umweltbewusste Schweizer lehnen die Regierungspläne als halbherzig ab. Sie wollen die fünf Kraftwerke in der Schweiz so rasch wie möglich stilllegen. Laut ihrem Konzept, über das die Schweizer entscheiden, werden Beznau 1 und 2 sowie das AKW Mühleberg schon 2017 abgeschaltet.
Atomtechnologie "nicht beherrschbar"
Das AKW Gösgen käme 2024 an die Reihe, Leibstadt 2029. Zudem soll per Verfassung der Bau neuer Atom-Anlagen verboten werden. Damit hätten die Schweizer – wie Deutschland auch – einen klaren Fahrplan in Richtung Ausstieg.
„Die Atomtechnologie ist nicht beherrschbar und ihre Risiken nicht kontrollierbar“, betont Regula Rytz, Vorsitzende der Grünen. Ihre Kampagne zielt zumal auf die Reaktor-Oldies in Beznau. Der älteste AKW-Park der Welt kämpfe permanent mit gravierenden Sicherheitsproblemen, die „sich mit keinen Nachrüstungen beheben lassen“. Beznau sei ein hochriskantes Feld-Experiment, das umgehend beendet werden müsse. Tatsächlich hatten die Betreiber wiederholt mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Derzeit bereiten Fehler im Beznau-1-Reaktordruckbehälter Kopfzerbrechen.
Um für die Zeit ohne Atomstrom gewappnet zu sein, verlangen die Grünen eine Energiewende: Der Ausbau erneuerbarer Quellen soll vorangetrieben werden, wie Solartechnik. „Wenn nur die Hälfte aller gut geeigneten Dach- und Fassadenflächen für Fotovoltaik genutzt werden, kann ein Viertel des Schweizer Stromverbrauchs produziert werden“, wirbt Felix Nipkow von der Schweizerischen Energiestiftung.
Bei einem Ja droht eine Lücke
Die Regierung traut diesen Rechnungen nicht. Vielmehr betont Energieministerin Doris Leuthard: Die fünf AKWs produzieren 40 Prozent des Schweizer Stroms – das Land sei nicht in der Lage eine entstehende Lücke mit erneuerbaren Energien rasch zu schließen. „Wenn wir im nächsten Jahr drei Kernkraftwerke abstellen, dann müssen wir über längere Zeit importieren: Kohlestrom aus Deutschland und Atomstrom aus Frankreich“, sagt Leuthard. Somit begebe sich die Schweiz in die Abhängigkeit von „Dreckstrom“ aus dem Ausland. Die Atombosse warnen vor Stromausfällen, falls die Bürger am Sonntag Ja sagen. „Bei einem sofortigen Ausstieg, wie ihn die Initiative will, besteht dieses Risiko“, unkt Thomas Sieber, Präsident von Axpo, Betreiber der Reaktor-Veteranen. Er setzt auf das bestehende Konzept der Regierung: Danach dürfen in der Eidgenossenschaft keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut werden.
Die Schweizer Kernkraftwerke
Die Schweiz deckt derzeit 40 Prozent ihres Energiebedarfs über Atomkraft ab. Dabei sorgen fünf Reaktorblöcke für Strom- Beznau I und II: Das dienstälteste Kernkraftwerk der Welt ist Beznau an der Aare. Sein erster Block nahm 1969, der zweite Block 1971 den Betrieb auf. Beide Blöcke haben eine unbefristete Betriebsbewilligung. Die Liste der Störfälle ist hier besonders lang. Bei Wartungsarbeiten wurden im Jahr 2015 beispielsweise in dem heruntergefahrenen Reaktorblock I 1000 Schwachstellen ausgemacht.
- Mühleberg ging 1972 in Betrieb, es liegt ebenfalls an der Aare. Das Kernkraftwerk soll am 20. Dezember 2019 aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt werden. Die Betreiberin reichte ein entsprechendes Gesuch für das 14 Kilometer von der Bundeshauptstadt entfernte Kraftwerk ein.
- Gösgen im Kanton Solothurn ist seit 1979 in Betrieb, 1996 wurde das Kraftwerk leistungsstärker gemacht, sodass der Reaktor 14 Prozent des Schweizer Stroms liefert.
- Leibstadt im Kanton Argau ist seit 1984 in Betrieb. Es ist das jüngste der Schweizer Kernkraftwerke. Es erzeugt ein Sechstel des Schweizer Stroms und könnte bis ins Jahr 2044 hinein laufen. Zu den Pannen der vergangenen Jahrzehnte gehören Wandbohrungen in der Hülle durch eine Fremdfirma, die dort Feuerlöscher anbrachte. Die Löcher wurden 2014 zufällig entdeckt und sorgten für Aufsehen.