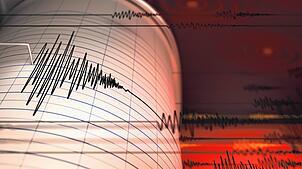Um die 1750 Pflanzenschutzmittel sind in Deutschland zugelassen. Würden wir komplett auf diese Herbizide, Insektizide und Fungizide verzichten, könnte es ein Triumph oder ein Debakel werden – Argumente gibt es für beide Szenarien.
Im besten Fall sind wir weniger Gesundheitsrisiken ausgesetzt, geht es den Böden besser und manch bereits verschwundenes Tier kehrt zurück. Im schlimmsten Fall breiten sich auf Feldern und Bäumen nicht behandelte Krankheiten aus, werden Lebensmittel durch geringere Erträge teurer und knapp. Und: Ein Hof nach dem anderen geht ein, weil die Anforderungen an die Landwirte ins Uferlose steigen – und sie nicht ausreichend entschädigt werden.
„Könnten den heimischen Markt nicht mehr abdecken“
Für Florian Fuchs, Juniorchef des Fuchshof in Konstanz-Dingelsdorf, ist der Fall klar: „Wir können natürlich gänzlich auf Pflanzenschutz verzichten, aber dann können wir keine Obstkulturen wie Äpfel oder Erdbeeren in der geforderten Qualität anbauen und können den heimischen Markt nicht mehr abdecken.“

„Lieber gebe ich 300 Jahre Betriebsgeschichte auf“
Wie auf dem Fuchshof setzt im benachbarten Litzelstetten auch Thomas Romer auf integrierte Produktion. Das heißt: Pflanzenschutzmittel kommen nur möglichst schonend zum Einsatz. Angesprochen auf steigende Anforderungen, hebt Romer die Augenbrauen: „So bitter es klingt, aber: Wenn der Anbau immer weiter eingeschränkt wird, gebe ich lieber 300 Jahre Betriebsgeschichte auf als meine Altersvorsorge aufs Spiel zu setzen.“

Die Schweizer konnten kürzlich selbst entscheiden, ob sie in einem Land ganz ohne chemische Pestizide leben wollen. Das Ergebnis bei zwei Initiativen, die darauf abzielten, war deutlich: Rund 60 Prozent sagten dazu Nein.
Experiment zeigt Folgen von pestizidfreiem Obstanbau
Ortsbesuch bei Reinhard Honsel, ein weiterer Bodanrück-Obstbauer, der auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Am Ortsausgang von Konstanz-Litzelstetten hat er eine Nullparzelle angelegt. Auf diesen Experimentierflächen findet keinerlei Pflanzenschutz statt – weder konventionell, noch ökologisch. In den vergangenen Tagen hat der Bodanrück reichlich Regen gesehen. Für Pilze ein Segen, für damit befallene Äpfel auf Honsels Nullparzelle ein Desaster.

Plakative Aktionen wie diese namens „Schau ins Feld!“ gibt es deutschlandweit. Sie sollen Verbrauchern zeigen, wie eine Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz aussähe. Weil es sich dabei um Lobbyarbeit mit Unterstützung der Agrarchemie-Branche handelt, sind sie umstritten.
„Bio heißt nicht ohne Pflanzenschutzmittel“
Trotzdem unterstreichen die von Schorf übersäten Blätter und unbrauchbaren Früchte auf Honsels Nullparzelle, worauf er und sein Sohn Heiko hinaus wollen. Der sagt: „Eine Mehrheit glaubt, Bio hieße ohne Pflanzenschutzmittel. Das stimmt schlicht nicht. Auch im Öko-Anbau kommt Pflanzenschutz zum Einsatz, nur eben andere Mittel.“
Bekanntestes Beispiel: Kupfer. Der ist in der Bio-Landwirtschaft als natürliches Mittel gegen Pilzerkrankungen zugelassen, das Schwermetall kann Böden aber ebenfalls schädigen. Alternativen gibt es für Obst- oder Weinbauern bisher wenige.
Politik diskutiert über Verzicht auf Pflanzenschutzmittel
Heimisches Obst und Gemüse decken Bedarf zu maximal einem Drittel
Laut Bundeslandwirtschaftsministerium kann der deutsche Apfelbedarf derzeit zur Hälfte mit einheimischen Produkten gedeckt werden. Über alle Obstsorten gerechnet liegt dieser Selbtversorgungsgrad bei 22 Prozent, beim Gemüse bei 36 Prozent. Groß verändert haben sich die Quoten seit 1990 nicht. Der übrige Bedarf muss importiert werden.
Auch deshalb sieht der Litzelstetter Obst-Bauer Thomas Romer reine Bio-Landwirtschaft kritisch. „Auch in Restaurants und Lebensmittelgeschäften gibt es nur noch Bio, überall“, sagt er und fügt leicht spöttisch an: Er sei der letzte Landwirt, der das nicht wollte: „Für unser Portemonnaie wäre es jedenfalls gut.“ Aber dann fragt Romer ernst: „Nur wer entscheidet dann, wen wir mit den dann noch produzierten Lebensmitteln ernähren wollen?“
Geringere Erträge, weniger Lebensmittel
Klar ist: Der Ertrag ginge deutlich zurück. Je nach Frucht und Studie gehen Wissenschaftler von durchschnittlich 50 Prozent geringerer Ernten gegenüber konventioneller Landwirtschaft aus. Das Problem, das auch Bio-Befürworter eingestehen: Bis Mitte des Jahrhunderts könnten knapp zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Beim Verzicht auf Chemie und gleich vielen Flächen würden die Lebensmittel nicht mehr zur weltweiten Ernährung reichen.
„Moralisch und ethisch unverantwortlich“
Deshalb hält Jürgen Riedlinger „den Fokus auf Bio, Bio, Bio“ für moralisch und ethisch unverantwortlich. Riedlinger ist Geschäftsführer des Fruchthof Konstanz und damit Abnehmer für die Obstbauern vom Bodanrück.

„Wir könnten uns den Verzicht vielleicht sogar noch leisten, aber die globalen Auswirkungen wären brutal“, sagt er.
Als brutal, zumindest aber schmerzlich empfinden die hiesigen Obstanbauer auch, dass ihr Berufsstand in Verruf gerät. „Wir Landwirte wissen noch, wie schwer das Leben und Arbeiten bei Wind und Wetter ist“, sagt beispielsweise Thomas Romer. „Für den Einsatz zur Versorgung der Menschen noch angefeindet zu werden, das tut weh.“
„Glyphosat-Diskussion will ich Mitarbeitern nicht antun“
Es ist mit ein Grund, warum Glyphosat bei ihm auch nicht mehr aufs Feld kommt, „obwohl das eigentlich Unsinn ist“. Die Folgen für den Verzicht des meistverkauften, aber wegen möglicher Krebserregungen auch umstrittensten Breitband-Pestizids laut Romer: mehr Traktorfahrten zuungunsten der CO2-Bilanz und des Lebens im Boden; mehr Aufwand und jährlich Zehntausende Euro höhere Kosten für seinen Betrieb. „Und trotzdem: Meinen Mitarbeitern auf dem Markt will ich die Glyphosat-Diskussion nicht antun“, sagt er.
Hat der Obstbau am Bodanrück noch eine Zukunft?
Auch Florian Fuchs erlebt die Diskussion um Pestizide als zu sehr von Emotionen und zu wenig von Fakten bestimmt: „Etwas zugespitzt gesagt, wird uns Landwirten wegen jedem verendeten Tier und jeder kaputten Pflanze der Schwarze Peter zugeschoben. Auf dieser Ebene kommen wir aber keinen Schritt weiter.“
Mit Mitte 30 hat er noch eine lange berufliche Zukunft vor sich? Wenn es nach Fuchs geht auch auf dem Feld. Er sei Obstbauer aus Idealismus und die langfristigen Aussichten seien gut. „Wir werden wieder mehr heimische Lebensmittel benötigen als im Moment. Es könnte also einfacher werden, wenn wir lange genug durchhalten.“