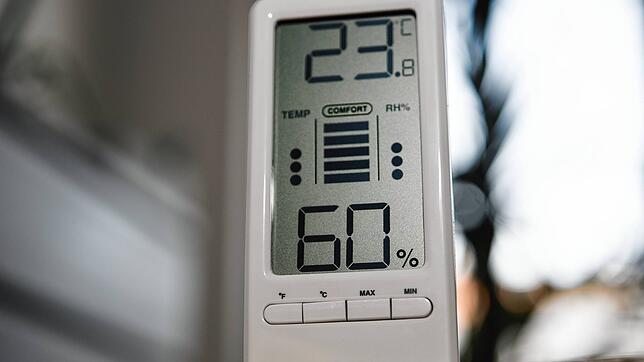Woher kommt Schimmel in Wohnungen überhaupt?
Schimmelsporen sind überall in der Luft. Wenn sie einen Nährboden finden, dann wachsen sie. „Dazu brauchen sie eine recht hohe Luftfeuchtigkeit“, sagt Gunnar Grün, Leiter der Abteilung Energieeffizienz und Raumklima am Fraunhofer Institut für Bauphysik. Durch Schwitzen, Atmen, Duschen, Putzen oder Kochen kommen in einem Vier-Personen-Haushalt täglich rund zwölf Liter Wasser zusammen – genug Feuchtigkeit für die Schimmelpilze.
„Im Sommer ist das Schimmelrisiko geringer, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte“, sagt der Bauphysiker. Hinzu kommt, dass bei warmen Temperaturen automatisch viel gelüftet wird, wodurch Feuchtigkeit nach draußen gelangt. Ist die Luft im Winter dagegen kalt, kann sie nicht alle Feuchtigkeit aufnehmen. Die Folge: die Feuchtigkeit kondensiert, wird wieder zu Wasser und sammelt sich an kalten Ecken in der Wohnung, beispielsweise an Fenstern oder Außenwänden.

Wenn jetzt im Winter die Heizungen runtergedreht werden sollen: Erhöht das nicht das Schimmelrisiko?
Das kommt auf das Gebäude an. „Wer in einem gedämmten Neubau wohnt, kann die Heizung ruhig runterdrehen“, sagt Norman-Marcel Dietz, Bauherrenberater beim Verband privater Bauherren. Denn eine gedämmte Fassade verliert erst gar nicht so viel Wärme, dass die Wände stark auskühlen und somit zu einem Problem für Schimmel werden würden.
Anders sieht es im ungedämmten Bestandsbau aus, zu dem auch sehr viele Mehrfamilienhäuser gehören. „Hier haben wir die typischen Wärmebrücken, beispielsweise an Fensterrahmen oder in den Ecken“. Diese Stellen leiten die Wärme schneller nach außen als die Bauteile in der Umgebung. Dadurch kühlen sie schneller aus und das macht diese Stellen anfällig für feuchte Raumluft, die dort dann kondensiert. „Damit das nicht passiert, muss ein solches Gebäude ausreichend geheizt werden“, sagt Norman-Marcel Dietz. Denn warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte.
Und wenn ich in so einem Gebäude dennoch weniger heizen möchte: muss man dann Schimmel in Kauf nehmen?
„Wenn ich weniger heize, muss ich mein sonstiges Verhalten auch ändern, sonst wird es tatsächlich mehr schimmeln“, sagt der Bauphysiker des Fraunhofer Instituts. Das Wichtigste sei: mehr lüften und richtig lüften. Zwei- bis dreimal am Tag sollten die bewohnten Räume einer Wohnung komplett durchgelüftet werden, so dass die Luft darin ausgetauscht wird – und zwar durch Stoßlüften. Kipplüften dagegen kühlt die Außenwände aus, ohne dass genügend Feuchtigkeit entweicht.
„Im Schlafzimmer macht man direkt morgens die Fenster weit auf, damit die feuchte Luft vom Schlafen sich gar nicht erst an Fenstern oder Wänden festsetzt“, sagt Gunnar Grün. Bettdecken bleiben aufgeschlagen, damit die Feuchtigkeit aus den Matratzen entweichen kann. Eine weitere Schimmelquelle: Mit Möbeln zugestellte Außenwände. Neben Fenstern gehören diese Wände zu den kältesten Flächen eines Raums, weshalb sie besonders anfällig für Schimmel sind, wenn sie nicht abtrocknen können.
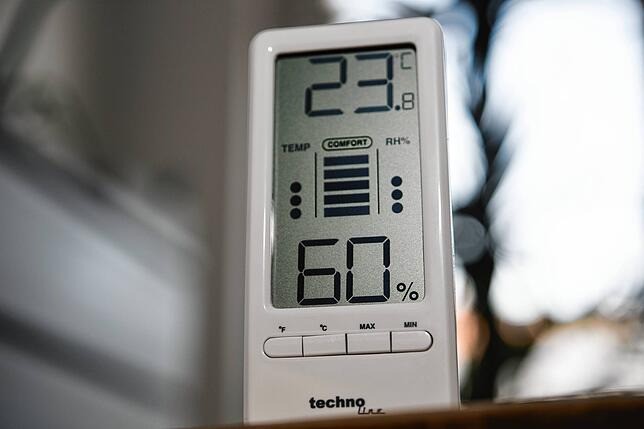
Verbraucht das ständige Lüften nicht viel Heizenergie?
Nein. Fünf Minuten Stoßlüften kostet kaum Heizenergie. Denn die Frischluft wärmt sich rasch wieder auf. Und gerade trockene Winterluft kann besonders viel Feuchtigkeit aus den Räumen aufnehmen und hinausbefördern. „Es gilt aber, die Fenster rechtzeitig wieder zuzumachen. Wenn man das vergisst und im Winter eine Viertelstunde lüftet, dann ist der Raum so ausgekühlt, dass man sehr viel Heizenergie verbraucht, um es wieder warm zu bekommen“, sagt der Bauherrenberater beim Verband privater Bauherren, Norman-Marcel Dietz.
Wie sieht es mit Wäschetrocknen in der Wohnung aus?
Aus der Wäsche entweicht beim Trocknen viel Feuchtigkeit. Gunnar Grün würde sie, wann immer es geht, auch im Winter deshalb draußen trocknen. „Wenn es nicht gerade Nebel hat, geht das durchaus, das dauert nur vielleicht ein bisschen länger.“ Eine andere Möglichkeit ist ein Wäschetrockner – der jedoch viel Energie verbraucht.
Wie verhält man sich beim Duschen oder Kochen?
Auch hier gilt: die entstandene Feuchtigkeit möglichst sofort aus dem Raum befördern. Sprich Fenster auf – und zwar ganz, nicht nur gekippt.
Kann man in einzelnen Räumen im Winter die Heizung einfach ausschalten?
Angst vor zu kalten Räumen oder gar gefrorenen Leitungen muss keiner haben, der Heizkörper mit Thermostat besitzt. „Stellt man die auf das Schneeflockensymbol, schaltet sich der Heizköper ja automatisch an, bevor es zu kalt wird“, sagt Gunnar Grün. Wichtig sei nur, bei solchen kalten Räumen unbedingt die Tür geschlossen zu lassen. „Andernfalls kommt die feuchte Luft aus den genutzten Räumen in den kalten Raum. Und dann bekommt man dort tatsächlich ein Schimmelproblem“, sagt Gunnar Grün.
Vorsicht ist laut Norman-Marcel Dietz geboten, wenn man in einem ungedämmten Altbau wohnt – und womöglich neue Fenster eingebaut hat. „An den alten Fenstern hat man die Feuchtigkeit noch gesehen, wenn sie kondensiert. Mit neuen Fenstern schlägt sie sich eben an den Wänden daneben nieder und das bleibt meist so lange unbemerkt, bis sich Schimmelflecken zeigen.“

Was können Vermieter tun, die Angst davor haben, dass ihre Wohnungen nun verschimmeln?
In manchen Mietverträgen stehen Verpflichtungen, die eine bestimmte Mindesttemperatur beim Heizen vorschreiben – das Wirtschaftsministerium plant jedoch, diese zu kippen. „Ich kann meine Mieter mit einem Schreiben aber dann zumindest noch dafür sensibilisieren, dass sie dreimal täglich stoßlüften sollten, um das Schimmelrisiko zu minimieren“, so Gunnar Grün.
Zeigt sich beim Auszug Schimmel, muss im Zweifelsfall vor Gericht und über ein Gutachten geklärt werden, ob wirklich der Mieter durch sein Verhalten daran schuld ist und für die Beseitigung zahlen muss.
Zum Gesundheitsrisiko: Wie gefährlich ist Schimmel denn in Wohnräumen?
„Nur eine Minderheit der Schimmelpilze beeinträchtigen die Gesundheit direkt“, sagt Gunnar Grün. Alle können jedoch allergische Reaktionen wie Asthma hervorrufen, wenn Menschen ohnehin dafür anfällig sind. „Auch immungeschwächte Personen sind gefährdet“, sagt Norman-Marcel Dietz.