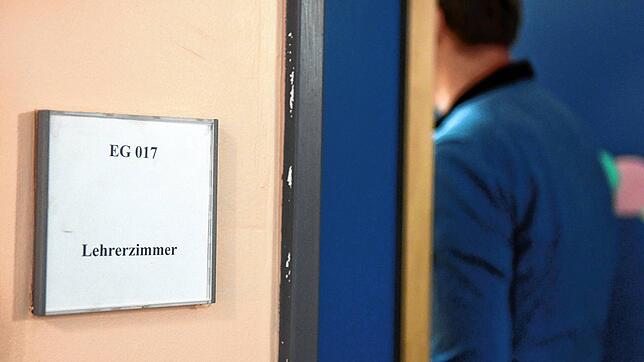Plötzlich geht die Tür auf, der Vater eines Schülers stürmt mit zwei weiteren Personen in das Büro des Schulleiters, schlägt Michael Kirchgäßner auf die Brust, schubst ihn gegen eine Wand und schreit: „Ich werde dich in den Boden schlagen, ich hau dir aufs Maul!“ So schildert Kirchgäßner, Lehrer an einer Schule im Kreis Konstanz, einen Vorfall, der sich vor etwa zwei Jahren ereignet haben soll. Kirchgäßner heißt in Wahrheit anders, um nicht noch weitere Angriffe auszulösen, möchte er anonym bleiben – so wie alle Lehrer, die dem SÜDKURIER von Übergriffen auf sie berichten.
Der Anlass für den Ausraster? Kirchgäßner sagt, er sei dazwischen gegangen, als der Sohn des Mannes sich mit einem Mitschüler prügelte. Als die Schwester des Jungen das sah, habe sie ihre Familie angerufen. Während der Lehrer das Opfer im Büro des Schulleiters verarzten ließ, seien auf einmal etwa 20 Familienmitglieder vor der Schule gewesen.
Um Schlimmeres zu verhindern seien nach der Attacke etliche Kollegen eingeschritten und drängten den Angreifer aus dem Büro. Dabei habe er einer Kollegin gedroht, ihr alle Zähne auszuschlagen. Es sei „eine brenzlige Situation und der Mann ein bedrohlicher Kerl“ gewesen, erzählt der Lehrer.
„Skandalöse Zustände“: Körperliche Gewalt an jeder vierten Schule
Michael Kirchgäßner ist kein Einzelfall. Das zeigt eine aktuelle Studie des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Die Umfrageergebnisse lesen sich erschreckend: An 60 Prozent der Schulen in Baden-Württemberg gab es demnach psychische Gewalt, also Beschimpfungen und Bedrohungen gegen Lehrkräfte – 14 Prozent mehr als noch 2018.
An jeder dritten Schule kam es zu Cyber-Mobbing gegen Lehrkräfte, also zu Diffamierungen im Internet – doppelt so viel wie 2018. Und an 25 Prozent der Schulen wurden Lehrer sogar körperlich angegriffen. Zudem erstatten laut VBE-Umfrage nur sieben bis neun Prozent der Betroffenen Anzeige, die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen.
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand spricht angesichts der Zahlen von „skandalösen Zuständen“. Körperliche Gewalt sei früher eine „extreme Ausnahme“ gewesen, heute beschäftige es ihn immer wieder, berichtet auch dessen Stellvertreter Dirk Lederle, der selbst Schulleiter an einem Schulzentrum aus Grund-, Werkreal- und Realschule in Heitersheim ist. „Alle Schultypen sind betroffen“, so Lederle.
Auch Schulen im ländlichen Raum betroffen
Und es geht nicht nur um so genannte Problemschulen in größeren Städten – selbst im beschaulichen Südbaden gibt es weitere Fälle. Nicht immer geht es um körperliche Gewalt, auch mit anderen Mitteln wird gearbeitet: Florian Köhler, Lehrer an einer Realschule im Schwarzwald-Baar-Kreis, wurden von der Mutter einer Schülerin „perverse Gelüste“ gegenüber ihrer Tochter vorgeworfen, was er als „krasse Unterstellung“ empfand. Sie habe den Vorwurf sogar publik machen wollen. Zuvor habe er die Tochter lediglich angesprochen, weil die einen verbotenen Gegenstand dabei gehabt habe.
Und Sarah Reinke, an der selben Schule tätig wie Michael Kirchgäßner im Kreis Konstanz, erlebte einen Vorfall mit dem gleichen Vater wie ihr Kollege. Auch damals sei dessen Sohn in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Reinke sah das auf dem Pausenhof und schritt ein. Zu dem Zeitpunkt sei die Familie des Jungen bereits auf dem Schulgelände gewesen – wegen einer Schlägerei des Jungen in der Pause zuvor.
Der Vater habe sie am Arm gepackt und geschrien, er würde ihr eine Backpfeife geben, wenn sie seinen Sohn nicht mitprügeln lasse. „Ich hatte richtig Angst und bin einfach stehen geblieben. Ich konnte nichts dazu sagen“, erzählt sie von dem schockierenden Erlebnis.
Lehrer trauen sich nicht mehr, einzuschreiten
Und solche Übergriffe haben Folgen: „Wir reden im Kollegium noch immer darüber. Bei bestimmten Kindern drücken wir beide Augen zu, weil sonst wieder die Eltern kommen würden. Es ist hart, wenn man weiß, womit man rechnen muss, wenn man einschreitet“, beschreibt Reinke.
Dirk Lederle vom VBE bestätigt den Eindruck, dass oft die Eltern das Problem seien. „In den berühmten WhatsApp-Elterngruppen, die man unter dem Titel „Frau Müller muss weg“ zusammenfassen könnte, ist Mobbing von Lehrern keine Seltenheit. Da werden Gerüchte gestreut und weiterverbreitet, um den Ruf von Lehrern zu zerstören“, berichtet er.
Lehrermangel, Migration und Corona mögliche Ursachen
Doch was sind die Gründe für diese Entwicklung? Dirk Lederle erklärt: „Der Mangel an sozialen Kontakten und der gestiegene Medienkonsum in den Pandemie-Jahren hat die Kinder verändert.“ Zudem gebe es in der gesamten Gesellschaft weniger Respekt und mehr Aggressionen, die Schulen könnten sich davon nicht abkapseln.
Jeanine Grütter, die als Hochschuldozentin für Schulpädagogik an der Uni Konstanz forscht, stimmt zu: „In unseren eigenen Studien sehen wir, dass es mehr Kinder mit psychischen Auffälligkeiten gibt. Wir haben Risikoprofile von Kindern erstellt in der Pandemie. Ein Fünftel war auffällig.“ Sie fühlten sich zu wenig unterstützt, überfordert, anfällig für Depressionen und Ängste oder sogar hoffnungslos in Bezug auf ihre Zukunft.
Auch Eltern sind überfordert – und reagieren mit Gewalt
Einen Automatismus, dass solche Belastungen zu Gewalt führen, gebe es nicht. Aber in manchen Situationen würden Menschen bei Überforderung mit Aggressionen reagieren. Dies betreffe sowohl Kinder und Jugendliche, aber könne auch bei Eltern vorkommen, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen können.
Fatal sei in dieser Situation der Lehrermangel. Eigentlich brauche es mehr Beziehungsarbeit, gerade weil die Klassen immer heterogener werden. „Aber dieses soziale Miteinander können wir immer weniger leisten. Und weniger soziales Miteinander macht Gewalt wahrscheinlicher“, berichtet Dirk Lederle aus dem Schulalltag.
Ein weiteres Beispiel für die Folgen dieser Entwicklung ist Anna Sommer, eine Kollegin von Michael Kirchgäßner und Sarah Reinke aus dem Kreis Konstanz. Sie berichtet, dass ein Vater ihr gedroht hat, sie solle besser gut auf sich aufpassen, wenn sie ein Bußgeld nicht zurücknehme, das er wegen unentschuldigten Fehltagen seines Kindes bekommen hatte. „Das war schon eine ordentliche Drohung, die ich ernst genommen habe“, sagt sie.
Lehrer beklagen fehlende Unterstützung durch Behörden
Das Problem: Schulen können solche Fälle nicht anzeigen, das muss der einzelne Lehrer selbst machen. „Das will sich aber niemand antun, dadurch exponiert man sich als einzelner nur noch weiter“, erklärt Sommer. Manche würden weitere Ausraster fürchten, andere wollten wegen des Schulfriedens kein weiteres Öl ins Feuer gießen. „Ich hätte schon Angst, dass mir dann vielleicht jemand auflauert“, so die Lehrerin.
Hinzu kommt, dass einige Betroffene sich bei einer Anzeige nicht ausreichend unterstützt fühlen durch Polizei und Schulbehörden. Michael Kirchgäßner, der nach dem Angriff auf ihn Anzeige erstattete, erzählt: „Nach sechs Monaten hat die Polizei nachgefragt, ob ich den prügelnden Vater tatsächlich anzeigen will, dann würde man die Anzeige weitergeben.“
Ein halbes Jahr lang sei also nichts passiert. „Ich habe mich im Stich gelassen gefühlt“, berichtet er. Denn auch seinen Wunsch, den Jungen nicht unterrichten zu müssen, habe das zuständige Schulamt nicht erfüllt. Kirchgäßner ist noch immer dessen Klassenlehrer.
Seine beiden Kolleginnen, Anna Sommer und Sarah Reinke, teilen den Eindruck. „Man fühlt sich nicht ernst genommen, weil diese Fälle keine Konsequenzen haben“, sagt Reinke. Schüler, die wiederholt auffällig werden, würden nicht an andere Schulen versetzt, Verweise nicht immer akzeptiert.
Welche Rolle spielt das Kultusministerium?
Die Ergebnisse der VBE-Studie zeigen, dass die Betroffenen aus der Region mit diesem Eindruck nicht alleine sind. Demnach haben nur 23 Prozent der Schulleitungen das Gefühl, dass mit Gewalt gegen Lehrer offen umgegangen wird. Dirk Lederle vom VBE schließt zwar klar aus, dass es unerwünscht ist, solche Vorfälle zu melden.
Aber: Das Regierungspräsidium habe eine Doppelrolle – einmal als Aufsichtsbehörde bei Verstößen der Lehrer und zeitgleich als deren Unterstützer. „Vielleicht haben Kollegen daher Angst, sich dorthin zu wenden, und erdulden Vorfälle lieber still und heimlich“, erklärt Lederle.
Das Kultusministerium betont auf Nachfrage, man ermuntere Betroffene, die Vorfälle bekannt zu machen: „Unsere Ministerin hat deutlich betont, dass alle mit der vollen Rückendeckung des Ministeriums rechnen können.“
Forscherin fordert mehr Sozialarbeiter und Psychologen an Schulen
Zudem steht der VBE Betroffenen beratend und juristisch zur Seite. Und an Schulen und bei den Regierungspräsidien gibt es psychologische Betreuungsangebote, die laut Lederle allerdings oft noch schambehaftet seien. Er sei „zuversichtlich, dass die Landesregierung das angeht, weil man in Stuttgart begriffen hat, dass es Veränderungen braucht“.
Wie die aussehen könnten, weiß Forscherin Jeanine Grütter: Mehr Schulsozialarbeiter, mehr Lehrkräfte, umfassende Prävention durch Förderung sozialer Kompetenzen und des Zugehörigkeitsgefühls an Schulen. „Es gibt einen großen Bedarf nach Unterstützung für belastete Kinder und Jugendliche, der noch größer werden wird.“
Auf die Schulen komme immer mehr Betreuungsarbeit zu. „Statt Einzelkämpfertum sind Unterstützungsnetzwerke für Lehrpersonen, Schülerinnen und deren Eltern in multiprofessionellen Teams wichtig“, sagt sie.