„Wie gut wir sind, zeigt sich in Krisenzeiten“, so lautet der Titel des Buches, das Ende vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Im SÜDKURIER-Gespräch erläutert Jeannette zu Fürstenberg die inhaltlichen Kernpunkte und die Zielrichtung ihrer Publikation. Mit ihrem „Weckruf“ verbindet sie die Hoffnung, zu einem Bewusstseinswandel im Lande beizutragen. Es gebe, so schreibt sie, „derzeit einfach viele, die den vermeintlich berechtigten Pessimismus propagieren und damit zur aktuellen negativen Mindset-Kultur unmittelbar beitragen. Kein Wunder, dass sich diese längst ihren Weg in die Köpfe großer Teile der Bevölkerung gebahnt hat“.
Gegen die allgemeine Krisengemütslage ruft sie zu mehr Aufbruchsstimmung und Chancen-Optimismus auf. Dabei nennt sie die diversen Krisen beim Namen: Sie erwähnt die „Flüchtlingskrise“, die „Klimakrise“, die „veraltete Infrastruktur“ und ein „schwer vernachlässigtes und vor allem falsch gesteuertes Bildungssystem“. Nun bewegt sich Frau zu Fürstenberg beruflich im Feld der Ökonomie, sie ist spezialisiert auf die Einwerbung und Investition von Finanzkapital in Risiko-Start-ups. Daher steht auch die Wirtschaftskrise im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, auch hier wieder unterlegt mit der Ablehnung eines „falschen Krisennarrativs“.
Wirtschaftliche Renaissance Europas?
Die Idee: innovative, vor allem durch Künstliche Intelligenz (KI) getriebene junge Start-ups zu fördern und mit dem traditionell soliden Industriepotenzial – „einer blühenden europäischen Unternehmerlandschaft“ – so zu vernetzen, dass sich wieder ein breites Wirtschaftswachstum einstellt. Die zeitliche Erwartung: „Bis zum Jahr 2040 kann es uns gelingen, mit drei Unternehmen in die Liga der zehn weltweit größten Technologiekonzerne vorzustoßen. Dies könnte in einer wirtschaftlichen Renaissance Europas münden.“
Einen Großteil ihrer Zeit verwendet zu Fürstenberg folglich darauf, in Europa Technologie-Gründer aufzuspüren, die sich aufgrund ihrer Fachkompetenz und ihres Pioniergeistes als Kapitalnehmer empfehlen. Der „Weckruf“ erzählt daher auch Kennenlern-Geschichten: Die Risiko-Investorin erlebt mit ihrem „Gegenüber eine Synchronisation der interpersonellen Schwingungen“, die auf einem geteilten Aufbruchsenthusiasmus beruht.
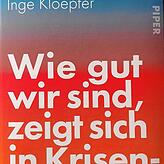
Überhaupt enthält sich das Buch jeden wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbuchtons. Dass die Schrift kurzweilig zu lesen ist, liegt vor allem an seiner sehr authentischen Ich-Perspektive. Die Autorin begründet ihre strategischen Perspektiven weniger mit ökonomischen Daten als mit anekdotischen Erfahrungen und mit ihrem Glauben an die Kraft unternehmerischer Visionen. Erwartungsgemäß verurteilt sie auch „die öffentliche Skepsis gegenüber dem Unternehmertum an sich“. Bedenkenträgerei lehnt sie ab.
Keine Angst vor KI-Anwendungen
Zwar erkennt sie bei den rapide voranschreitenden KI-Anwendungen durchaus das Risiko eines zukünftigen „Persönlichkeits- und Realitätsverlusts“, sogar einer „bevorstehenden Entmündigung“, wendet sich aber im Gespräch sogleich gegen ein neues „Angstnarrativ“: „Keine neue Technologie ist Menschen zu Beginn immer nur geheuer, weil jeder Technologiesprung sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt, eine Upside und eine Downside. Das war übrigens auch schon so bei der Erfindung der Schrift, oder später des Buchdrucks. Ich glaube daran, dass es uns Menschen schon immer gelungen ist, uns mit derartigen Quantensprüngen zu arrangieren.“
Statt des Verharrens in Angst und Vorsicht, empfiehlt sie vehement eine „Flucht nach vorn“. Diesem Motto gemäß plädiert sie im Gespräch sogar für den Bau neuer Atomkraftwerke, freilich ausgestattet mit modernster Steuerungstechnologie.
Berührend zu lesen ist das abschließende Buchkapitel „Die Unsichtbaren“, in der die Autorin recht freimütig ihre Erfahrungen als Frau in einer von Männern dominierten Berufssphäre schildert. Inzwischen habe sie aber die Phasen „mangelnden Selbstbewusstseins“ und „schlechten Gewissens“ ihrer Familie gegenüber hinter sich gelassen und erfreue sich in der Branche eines „ausreichenden Ansehens“ und in der Familie eines bedenkenlosen Rückhalts.
Jeannette zu Fürstenbergs Buch gewinnt seine argumentative Kraft vor allem aus einem anschaulichen Erzählduktus und einem mit rhetorischer Verve gelegentlich beschwörend vorgetragenen Glauben an die Macht der Überzeugungen über die Realität. Wer dieses Credo teilen mag, ist in diesem populärwissenschaftlichen Sachbuch mit gesichertem Tiefgang gut aufgehoben.







