Es beginnt etwa eine halbe Stunde nach dem Essen. Dann muss Amelie Jürgens erbrechen. Es folgen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Durchfall. Doch das sind für sie nur die äußeren Symptome, wenn sie Gluten konsumiert. Die Erscheinungen klingen meist nach etwa zwei Tagen ab, sagt sie, aber in ihrem Inneren können schon Spuren von Gluten irreparable Schäden hinterlassen. Amelie Jürgens hat Zöliakie.
Antikörper gegen sich selbst
„Zöliakie ist eine schwerwiegende Entzündung des Dünndarms“, erklärt Abdulwahab Hassan. Er ist Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie am Helios Spital in Überlingen. Ausgelöst wird diese Entzündung von Gluten, dem Klebereiweiß von Getreide. „Wie andere Proteine wird Gluten durch Verdauungsenzyme in kleine Bruchteile, namentlich Aminosäuren, zerlegt und aufgenommen“, erklärt Hassan. Ein Bruchteil entgehe jedoch einer kompletten Zerlegung und gelange in die Immunzellen der Darmwand. „Normalerweise wird das durch Immuntoleranz als Freund erkannt“, formuliert er es. Nicht so bei Zöliakie-Patienten: „Bei ihnen erkennt das Immunsystem die unvollständig verdauten Glutenteile als fremde Eindringlinge, wie ein Bakterium oder Gift, und reagiert mit einer Entzündung“, führt der Arzt aus.
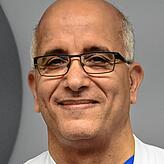
Das verkürzt jedoch die Darmzotten. Diese winzigen, fingerförmigen Ausstülpungen sind für die Nährstoffaufnahme zuständig, erklärt Hassan. Zöliakie kann deshalb unter anderem Eisenmangel, Osteoporose, Reizdarm bis hin zur Depression zur Folge haben sowie Wachstumsverzögerungen bei Kindern und weitere Autoimmunerkrankungen wie Typ 1 Diabetes.
Gewisse Ungewissheit
Mit dieser Krankheit ist Amelie Jürgens eine von vielen. Etwa ein Prozent der Bevölkerung hat Zöliakie. Seit den 1950er-Jahren ist die Anzahl Betroffener um das 4,5-fache gestiegen, sagt Hassan. Warum das so ist, sei bisher nicht letztgültig geklärt. Doch laut des Arztes verdichten sich die Hinweise, dass es mit Pflanzenschutzmitteln und Getreidezüchtung allgemein zusammenhänge.
Während des Gesprächs mit dem SÜDKURIER schwitzt Jürgens leicht, erwähnt sie. Auch diese Hitzeempfindlichkeit könnte mit ihrer Erkrankung zusammenhängen: „Mein Bruder hat auch Zöliakie und reagiert auf Wärme.“ Aber wie so vieles ist das eines der Dinge, die im Ungewissen bleiben. Kommt es durch die Krankheit, oder nicht? Klar ist nur: Etwas ist anders als bei anderen. Ein Aspekt, der Jürgens belastet.
Es fing in der Schule an. „Ich wurde immer labiler, war oft krank, hatte ständig Kopf- und Bauchschmerzen“, beschreibt sie. Die Diagnose bekam sie, als sie zwölf Jahre alt war. Die Transglutaminase-Antikörper waren im weit überdurchschnittlichen Bereich. Auch wenn Zöliakie in 99 Prozent der Fälle genetisch vererbt wird, ist in Jürgens Fall unklar, woher die Krankheit kommt. Ihre Mutter habe sich testen lassen, ihr Vater zeige keine Symptome. „Zöliakie zeigt zwischen 200 und gar keinen Symptomen“, sagt Gastroenterologe Abdulwahab Hassan. Sie sei das Chamäleon unter den Krankheiten. Dieser gestaltwandlerische Charakter zeigt die Ungewissheit, die die Krankheit nicht nur in Lehrbüchern, sondern auch im Alltag erzeugt.
Ständige Ausgrenzung
„Anfangs wollte ich es nicht akzeptieren“, sagt Jürgens. Doch weil ihre Mitschüler in den Pausen zum Bäcker gingen, ging sie auch dorthin und bestellte ein Croissant, weil sie den knusprig-weichen Blätterteig liebt. Ständig spielt Ausgrenzung eine Rolle, manchmal selbst gewählt, manchmal nicht. Amelie Jürgen erzählt, nur wer dort aß, durfte etwa in die Schulmensa. Für Jürgens keine Option, also aß sie auf dem Gang. Auch Geburtstage sagt sie ab, weil es ihr zu kompliziert vorkam. Wieder hätte sie sich erklären müssen, ihr eigenes Essen mitbringen müssen. Wieder wären da sie und die anderen.

Doppelte Butter, doppelter Preis
Für sie sei dieser psychische Druck immens. Immer könne es sein, dass sie es doch nicht verträgt. Wenn sie Restaurants besucht, dann meist die, die sich schon bewährt haben. Zu Hause wird ausschließlich glutenfrei gekocht – aber nicht nur glutenfrei gegessen. Ihr älterer Bruder teilt ihr Leiden, ihre anderen Geschwister und ihre Mutter nicht. Im Haushalt gibt es deshalb vieles doppelt: zwei Backöfen, zwei Schneidebretter, zwei Brotmesser, zwei Butter-Boxen. Alles, wo Spuren von Gluten liegen oder kleben bleiben können. Zu hoch ist die Kontaminationsgefahr.

Wie ein Sinnbild der Krankheit bewahrt Familie Jürgens glutenhaltige und zöliakiekonforme Lebensmittel getrennt voneinander auf. Zusätzlich getrennt durch die Konserven.

Weil die Krankheit unheilbar ist, ist glutenfreie Ernährung die einzige Therapie. „Ich fühle mich oft auch doppelt gestraft, weil die Preise für glutenfreie Produkte oft doppelt so hoch sind wie für normale Lebensmittel“, sagt Jürgens. Sie ernährt sich vegetarisch, würde es jedoch gerne vegan versuchen. Nur die Ersatzprodukte enthalten oft Milch- oder Molkepulver. Auch den vielen Verpackungsmüll bewertet sie kritisch. Mitunter vermisst sie das Verständnis anderer dafür, dass glutenfreie Ernährung kein Trend ist, sondern wie in ihrem Fall mit schwerwiegenden Folgen einer Krankheit zusammenhängt.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
„Mit Zöliakie muss man viel vertrauen“, sagt Amelie Jürgens. Die 19-Jährige berichtet von Köchen, die mehrfach bekräftigen, ihr Gericht sei glutenfrei, ohne es zu sein. Einmal habe sie eine Tomatensuppe bestellt. Geschmeckt hat sie, doch am Boden fand sie eine einzelne Nudel. Wieder startet ihr Körper seinen Kreuzzug gegen die fremden Organismen. Einmal aß sie Chips eines Herstellers, der sich bewährt hatte, doch er hatte die Rezeptur geändert, sodass nun Glutenspuren enthalten sind. Hin und wieder sieht sie sich auch dem Unglauben gegenüber, dass Gummibärchen, Chips oder Soßen Gluten enthalten können.
Glücksmomente aus Gemeinsamkeit
Das andere Gluten vertragen, neidet sie niemandem. Flammkuchen, Brezeln, Croissants sind Lebensmittel, die sie vermisst. „Manchmal macht es mich ein bisschen traurig, dass ich nicht mit der gleichen Leichtigkeit überall zugreifen kann“, sagt Jürgens.

Zu Glücksmomenten kommt es deshalb gerade dann, wenn die Trennung zwischen Original und Ersatz aufgehoben ist. Das ist jedoch eher in Italien oder Frankreich der Fall als in Deutschland. Sie berichtet von glutenfreiem Focaccia in Genua und einem glutenfreien Eclair in Aix en Provence. Während ihre Freundin das Brandteiggebäck mit Weizenmehl aß, genoss Jürgens das Eclair ohne Gluten.
„Es war das Leckerste, das ich je gegessen habe“, schwärmt sie. Und mehr noch: für sie war es ein geteilter Moment. Es war ein kleiner Ausschnitt der Einfachheit, nicht die zu sein mit der Extrawurst, die mit der Alternative. Die Gedanken ganz auf den Geschmack gerichtet, war es ein Augenblick, bei dem sie sich trotz chronischer Krankheit gesund fühlen konnte.








