Den Mitarbeitern der Notfallaufnahme im Klinikum Hochrhein bietet sich für gewöhnlich stets das gleiche Bild: Die Patienten sitzen dicht an dicht und warten nicht selten über Stunden, bis sie an der Reihe sind. Unter anderem weil nicht wenige Verletzungen tatsächlich ein Fall für die Notaufnahme sind. Doch in Zeiten von Corona hat sich auch hier einiges geändert.
Mit gravierenden Folgen für all jene Patienten, die bei Beschwerden zwingend die Anlaufstelle im Krankenhaus aufsuchen müssten. Sogenannte tödliche Kollateralschäden sind die Folge. Dies ist das Ergebnis einer Studie unter Leitung von Stefan Kortüm, Chefarzt der Notaufnahme im Klinikum Hochrhein. Ein Fazit: Chronisch kranke Menschen sterben einsam, weil sie das Krankenhaus meiden.

Im Frühjahr 2020 hatte die erste Welle der Corona-Pandemie auch das Leben im Landkreis Waldshut fest im Griff. Die Angst, sich mit dem Virus anzustecken war ebenso groß wie die Sorge, dass die Zahl der Intensivbetten im Klinikum Hochrhein und den anderen Spitälern der Region nicht ausreichen könnte. Möglicherweise war es genau diese Kombination, die vor allem chronisch Kranke davon abhielt, bei Beschwerden die Notaufnahme aufzusuchen, um sich dort behandeln zu lassen. So wie es für sie in der Zeit vor Corona üblich war. Ein tödlicher Irrtum, wie sich jetzt herausstellt.
„Wir haben im Frühjahr festgestellt, dass die Fallzahlen bei uns in der Notaufnahme dramatisch runter gegangen sind“, sagt deren Leiter und Chefarzt Stefan Kortüm. Das Klinikum Hochrhein habe dabei keine Sonderrolle eingenommen. Weltweit hätten sich die Meldungen gehäuft, dass die Fallzahlen in der medizinischen Notfallversorgung währen der ersten Phase der Corona-Pandemie erheblich zurückgegangen sind. Da auch in Waldshut der Unterschied zu der Zeit vor Corona auffällig hoch war, begab sich der Mediziner gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe auf Spurensuche.
Die Studie
Denn Experten befürchteten Gesundheitsschäden und Todesfälle durch ausbleibende oder verzögerte Inanspruchnahme medizinischer Hilfe bei akuten Erkrankungen, die mit Covid-19 nicht im Zusammenhang stehen. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von möglichen „Kollateralschäden“. Um verlässliche Zahlen zu bekommen, so Stefan Kortüm weiter, „haben wir uns die Frage gestellt, welche Erkrankungen sind weggeblieben?“ Gemeinsam mit der Integrierten Leitstelle Waldshut hat die Arbeitsgruppe das Geschehen im Zeitraum vom 24. Februar bis 31. Mai 2020 im Vergleich zu den vier Vorjahren analysiert.
Der Chefarzt: „Uns fehlten unsere Stammpatienten.“ Darunter versteht er nicht Bagatellverletzungen wie ein verknaxtes Hand- oder Fußgelenk, sondern chronisch Erkrankte, Menschen mit einer Herzpumpschwäche, Tumorpatienten, bei denen Komplikationen oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustand auftreten, und zum Beispiel auch Lungenerkrankte. Und das alles mit einer so großen Auffälligkeit, „dass wir uns fragten, was ist passiert?“ In der Notaufnahme des Klinikums Hochrhein lag die Zahl der zu behandelnden Fälle knapp 35 Prozent unter dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Rückgang der Einsatzzahlen gab es auch beim Rettungsdienst. „Allerdings nicht so intensiv wie bei uns.“ Die Einsätze gingen im Untersuchungszeitraum um knapp zwölf Prozent zurück. Im Klinikum stellten Chefarzt Kortüm und sein Team einen Rückgang der Fallzahlen um durchschnittlich 50 Prozent bei chronisch erkrankten Patienten fest. Betrachte man nur den Monat April, so der Mediziner, liege der Rückgang sogar bei mehr als 73 Prozent.
Signifikante Übersterblichkeit
Gleichzeitig sei im April eine Übersterblichkeit von mehr als 37 Prozent nachweisbar. Nach Herausrechnen der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen lag die Übersterblichkeit immer noch bei 16,8 Prozent und war „damit hoch signifikant“. Deshalb kommt Stefan Kortüm zu dem traurigen Fazit: „Die Chroniker sind nicht ins Krankenhaus gegangen und haben somit den Tod in Kauf genommen.“
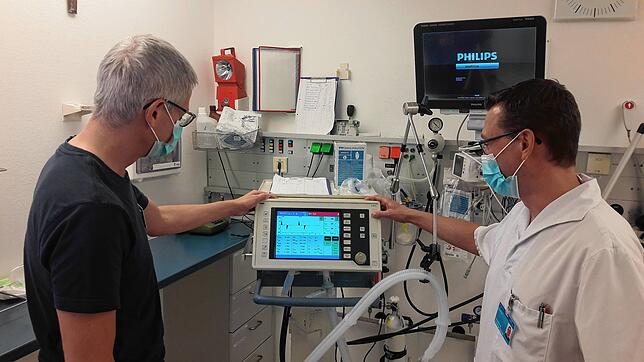
Während Patienten die Notfallaufnahme im Klinikum mieden, registrierte der Rettungsdienst eine „signifikante Zunahme der Notfallversorgungen ohne anschließenden Transport in ein Krankenhaus sowie eine auffallende Zunahme des Alarmierungsstichwortes ‚vermutlich Todesfeststellung‘ von plus 105 Prozent“. Fazit der Studie: „Die Zunahme der primären Todesfeststellungen im Rettungsdienst korrelierte signifikant mit dem Rückgang der stationären Notfallaufnahmen.“
Ursache und Wirkung
Dass es zu einer Übersterblichkeit in diesem Ausmaß gekommen sei, führt der Notfallmediziner nicht auf mangelnde Versorgungskapazitäten im Klinikum Hochrhein und anderen Krankenhäusern zurück. Vielmehr kritisiert er, „dass die Kommunikation in der ersten Welle nur auf Corona ausgerichtet war“. Weshalb er rät, künftig besser auf die Kommunikation zu achten.
Insbesondere bei älteren Chronikern komme hinzu, dass oft jüngere Familienangehörige auf Arztbesuche drängten. Wenn Kinder aber ihre chronisch kranken Eltern in Zeiten einer Pandemie nicht mehr besuchten, bleibe oft deren Drängen auf einen Arztbesuch aus. Stefan Kortüm macht in diesem Zusammenhang klar, dass er dies nicht als Vorwurf verstanden wissen will. Ihm gehe es darum zu lernen, „was wir besser machen können“.
„Gehen Sie ins Krankenhaus“
Deshalb wünscht sich der Mediziner, dass Kinder ihren kranken Eltern klar sagen: „Wenn es Euch schlecht geht, geht ins Krankenhaus.“ Diesen Weg könnten sie auch guten Gewissens antreten. Denn: „Unsere Hygiene- und Schutzstandards sind sehr hoch.“ Und er ergänzt: „Die, die unsere Hilfe wirklich brauchen, sollen kommen, sie sind bei uns sicher.“ Denn wer krank ist, gehöre ins Krankenhaus. Aktuell haben die Mitarbeiter der Notaufnahme „ordentlich zu tun, auch mit Nicht-Corona-Patienten“.
Und wie geht es Stefan Kortüm selbst, wenn er täglich zur Arbeit ins Spital geht? Grundsätzlich sei das Ansteckungsrisiko nirgendwo bei null. Aber: „Ich gehe mit einem besseren Gefühl zur Arbeit, als zum Einkaufen.“










